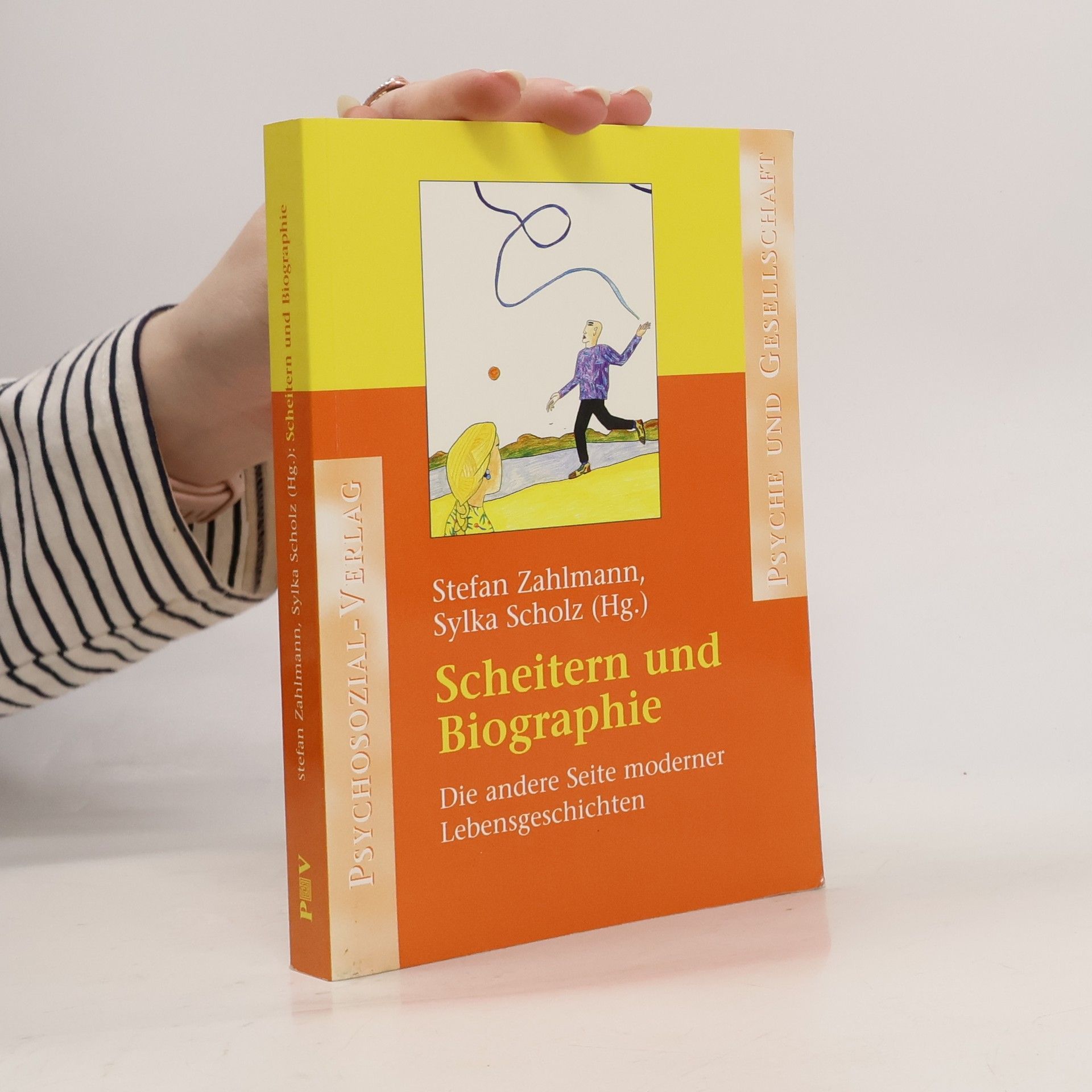Männlichkeitssoziologie
Studien aus den sozialen Feldern Arbeit, Politik und Militär im vereinten Deutschland
- 290 pages
- 11 hours of reading
Sylka Scholz untersucht aus einer männlichkeitstheoretischen Perspektive diejenigen sozialen Felder, welche für die soziale Konstruktion von Männlichkeit(en) zentral sind: Erwerbsarbeit, Politik und Militär. Im Mittelpunkt stehen solche Fragen wie: Welche Folgen haben Prekarisierung und Subjektivierung von Erwerbsarbeit für Männer und männliche Identitätskonstruktionen? Wie verändert der Eintritt von Frauen in Spitzenpositionen das männlich codierte politische Feld? Welche Bedeutung hat militarisierte Männlichkeit in einer ‚vereinten‘ Bundeswehr in Friedenseinsätzen mit ‚robustem Mandat‘? Ausgehend von einem modernisierungstheoretischen Konzept von Geschlechterverhältnissen untersucht sie, inwieweit auch 20 Jahre nach der politischen Vereinigung Unterschiede in Ost- und Westdeutschland bestehen. Das Buch gibt einen fundierten Überblick über den Stand der soziologischen Männlichkeitsforschung und diskutiert die Tragfähigkeit einschlägiger theoretischer Konzept unter den Bedingungen von Globalisierung und der zunehmenden Partizipation von Frauen an den sozialen Eliten.