Die Sammlung bietet unterschiedlichste Beispiele politischer Reden aus verschiedensten Epochen als Instrument der Herrschaft.Die Neuausgabe des gleichnamigen Bandes beleuchtet in einem ersten, allgemeineren Teil Redeanlässe, rhetorische Mittel und das Wie der Rede. Der zweite Teil bringt Ausschnitte aus bedeutsamen Reden, von u.a. Cicero, Friedrich dem Großen, Goebbels, Kennedy, Martin Luther King, von Weizsäcker, Joschka Fischer, George W. Bush und Barack Obama. An ihnen wird deutlich, dass bestimmte Elemente in den Reden der Herrschenden von der Antike an über Jahrhunderte erhalten geblieben sind.
Thomas Schirren Books
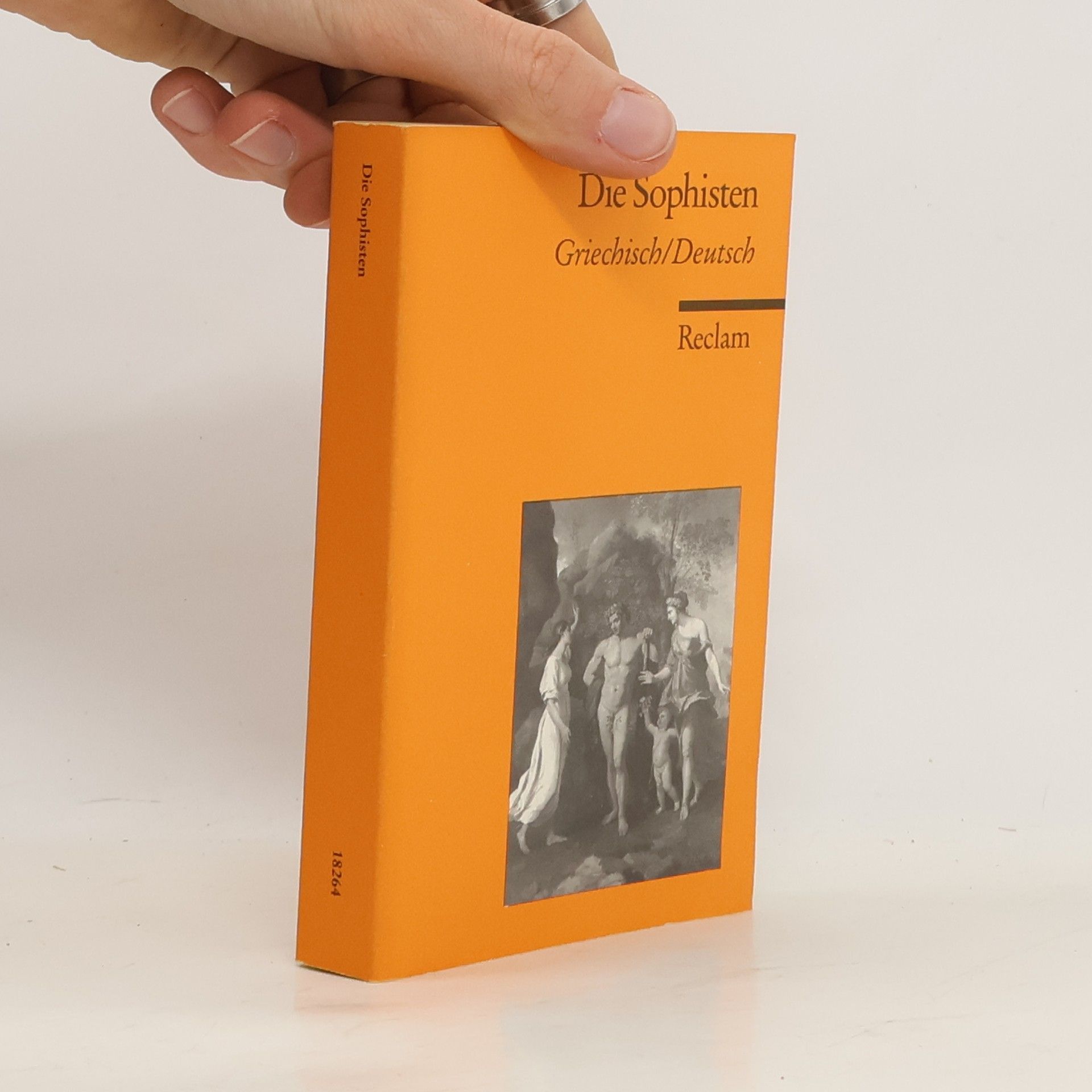
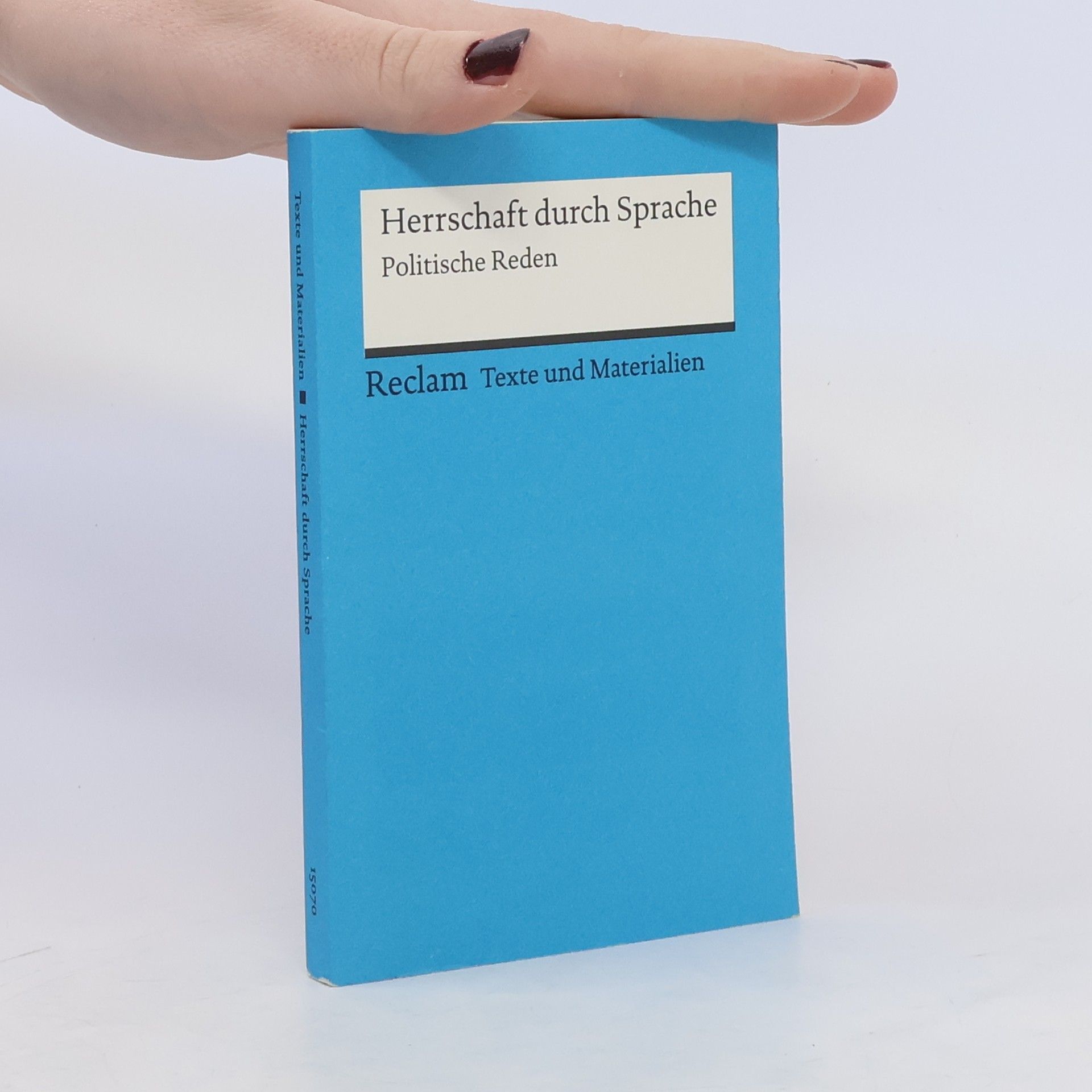
Die Sophisten
- 405 pages
- 15 hours of reading
Die Sophisten galten - vor allem aufgrund Platons heftiger Kritik - lange als „spitzfindig“ und „unredlich“. Doch dieses negative Urteil ist eine einseitige Verzerrung. Die intensiv kommentierte Auswahl von Primär- und Sekundärtexten zeigt die heute unumstrittene Bedeutung der Sophisten für Rhetorik, Dialektik, Philosophie, Religion und Wissenschaft ihrer Zeit. Sprachen: Deutsch, Griechisch (bis 1453)