Josef Mautner Books
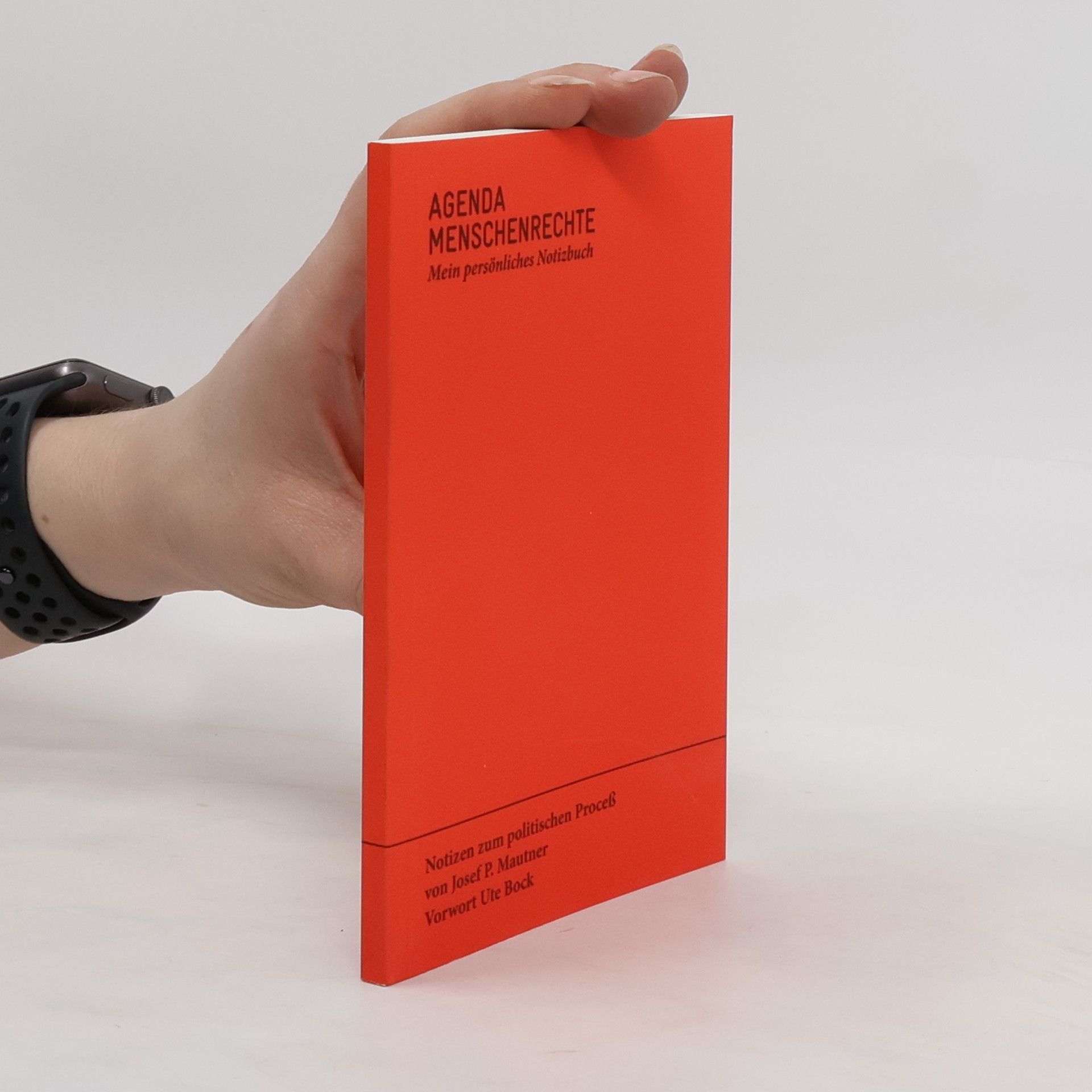

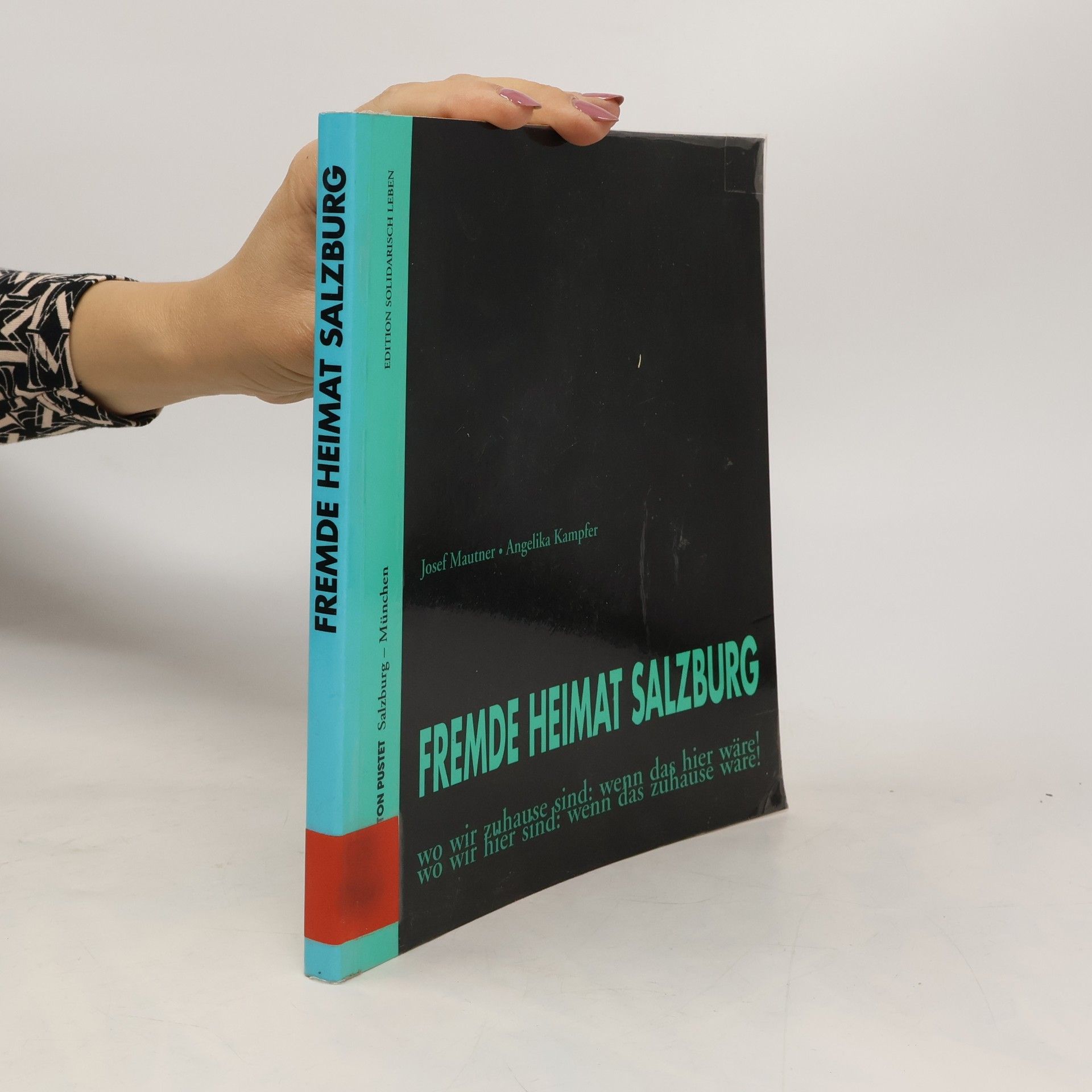
Regionale Menschenrechtspraxis
Herausforderungen – Antworten – Perspektiven
Menschenrechte sind vor allem als internationales Thema im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Wir denken an die Vertreibung der Rohingya in Myanmar oder an die Verhältnisse in den Flüchtlingslagern Libyens. Am ehesten hat das Recht auf Asyl als scheinbar zu begrenzendes Menschenrecht die innenpolitische Debatte in Österreich mitbestimmt. In den letzten Jahrzehnten hat sich jedoch ein vielfältiges Netz von Menschen, Gruppen und Organisationen gebildet, die sich in ihrem Heimatort, in ihrem Stadtteil, in ihrem sozialen Umfeld für Menschenrechte engagieren. In diesem Buch kommt eine lebendige und bunte Menschenrechtskultur zu Wort. Die AutorInnen der Beiträge eröffnen einen Blick auf eine offene und vielfältige Zivilgesellschaft.
Asylsuchenden und MigrantInnen wird in Österreich der Zugang zu Grundrechten regelmäßig erschwert. Internationale Menschenrechtsorganisationen prangern es stets von neuem an. Die Caritas, Amnesty International, die Plattform für Menschrechte, das Flüchtlingsprojekt von Ute Bock, kirchliche Stellen und andere führen einen unermüdlichen Kampf gegen den Zynismus des Staates und die Gleichgültigkeit der Gesellschaft. Der Prozess, der dem Einzelnen gemacht wird, mutet nicht selten so absurd an wie der gegen Josef K. in Kafkas berühmtem Roman: Angeklagt könnte potentiell jeder von uns sein. Von diesem Gedanken der Empathie ist das Notizbuch „Agenda Menschenrechte inspiriert, das Josef P. Mautner, seit Jahren in der Menschenrechtsarbeit tätig, herausgibt. Erfahrungsberichte aus seiner Praxis, Zitate aus Kafkas „Prozess“, die von Zeichnungen des verstorbenen Belgrader Architekten Bogdan Bogdanovic, selbst Migrant, illustriert werden, Adressen von Menschenrechtsorganisationen und dazu viel Raum für eigene Notizen: Die „Agenda Menschenrechte“, optisch ansprechend gemacht, gehört in die Hand von jedem, der etwas gegen die Gleichgültigkeit tun möchte.