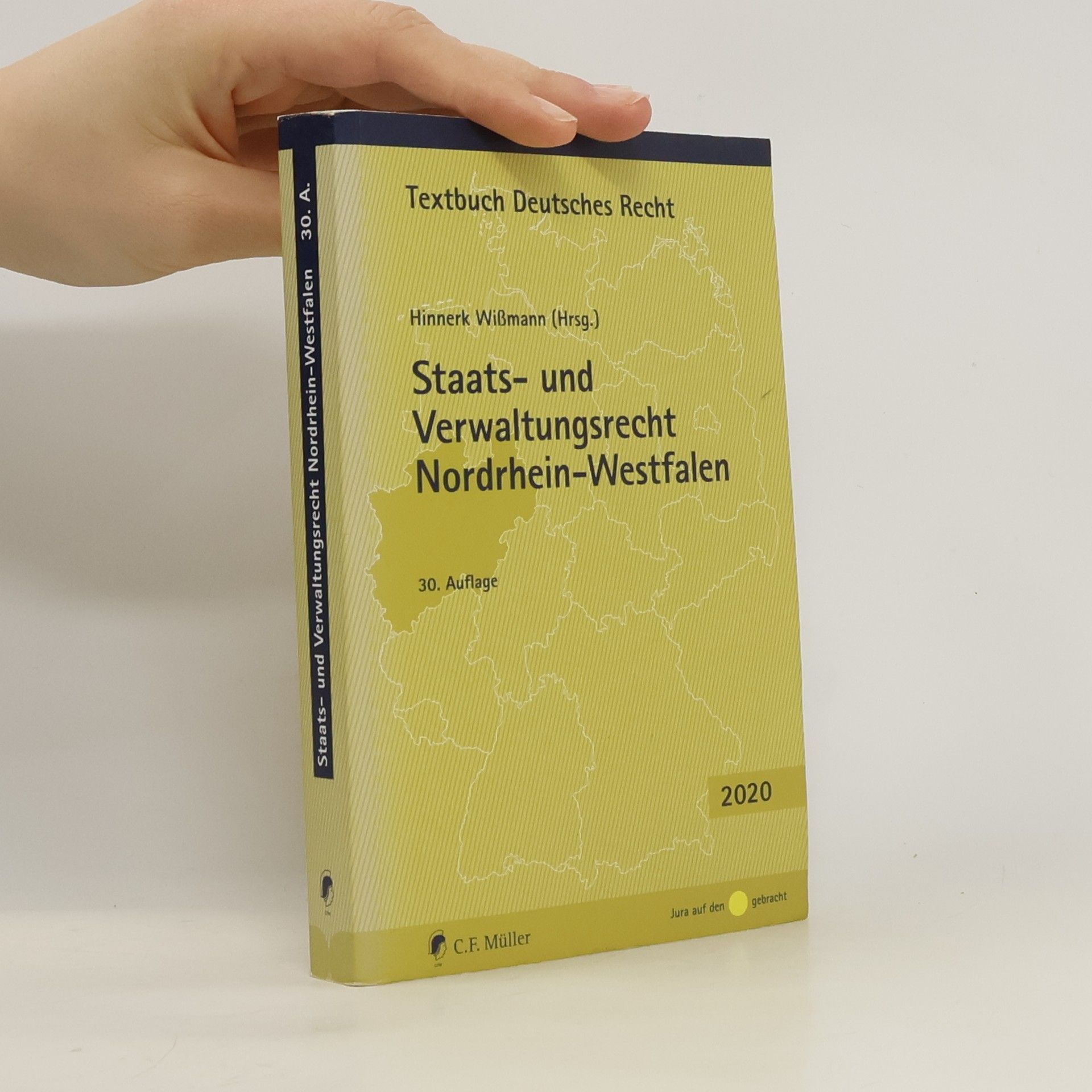Religionsunterricht 4.0
Eine religionspolitische Erörterung in rechtswissenschaftlicher und ethischer Perspektive
Die Autoren Arnulf von Scheliha und Hinnerk Wißmann analysieren die Weiterentwicklung des schulischen Religionsunterrichts im Kontext der wachsenden religiösen Pluralität und des demografischen Wandels. Sie betonen die Notwendigkeit, die bisherige Organisation zu überdenken, um die Ziele des Religionsunterrichts zu wahren. Ihre Bestandsaufnahme aus religionsrechtlicher und theologischer Sicht zeigt, dass eine zukunftsfeste Reform des Religionsunterrichts möglich ist und der rechtliche Rahmen flexibel genug ist, um notwendige Aushandlungsprozesse zwischen Staat und Religionsgemeinschaften zu unterstützen.