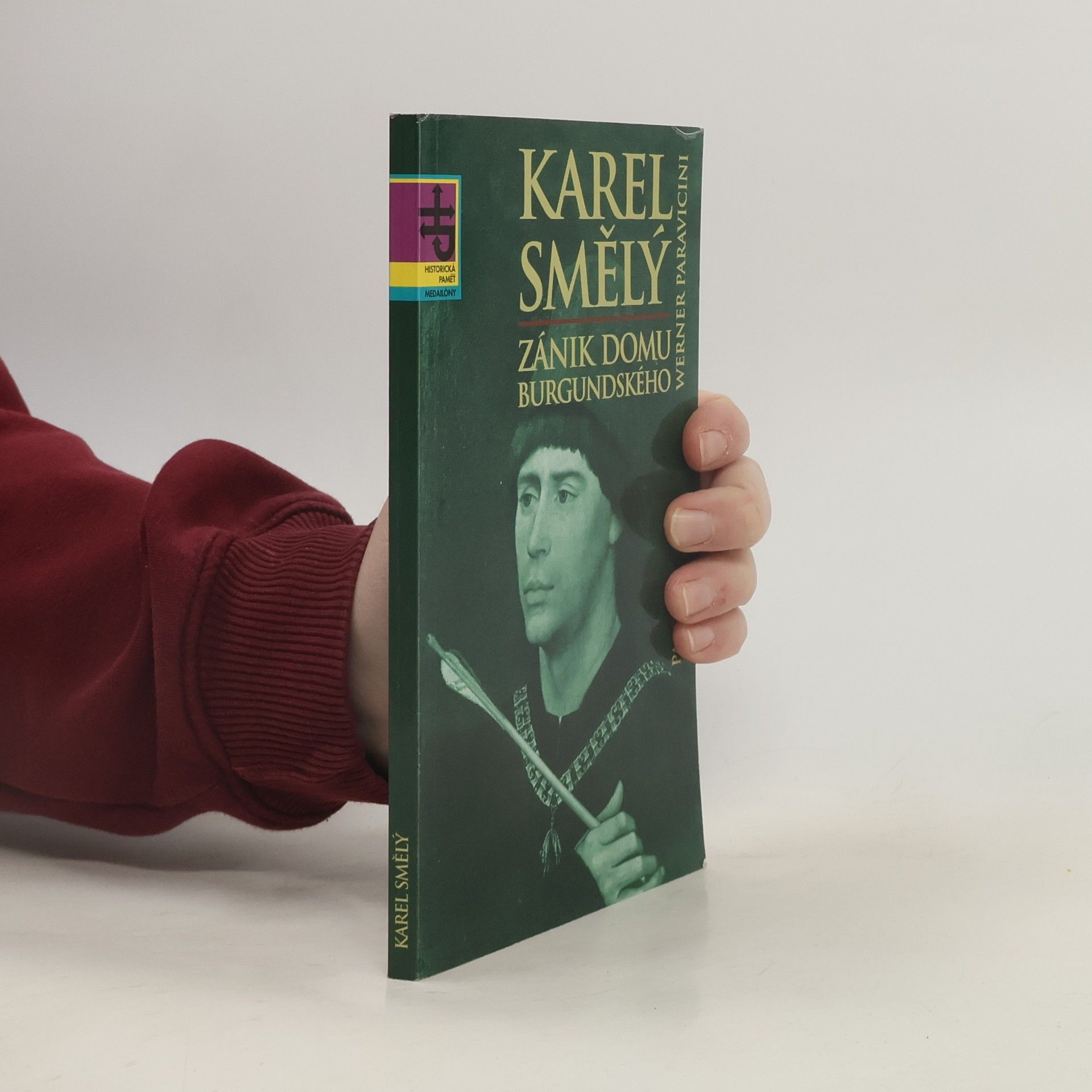Verlust und Dauer
Weshalb sie nicht mehr fuhren und was an die Stelle trat: Die Preußenreisen des europäischen Adels. Teil 4
- 596 pages
- 21 hours of reading
Der vierte und letzte Teil der "Preußenreisen" beschreibt das Ende dieser Reisen und ihre Folgen. Der Deutsche Orden setzte seinen Kampf gegen Litauen fort, während die europäische Ritterschaft sich gegen die Osmanen wandte. Eine neue Legitimität für Preußen erlaubte dem Orden, sich während des Konzils von Konstanz zu behaupten. Ein Fazit und weitere Dokumente folgen.