Slaves were property of their dominus , objects rather than persons, without rights: These are some components of our basic knowledge about Roman slavery. But Roman slavery was more diverse than we might assume from the standard wording about servile legal status. Numerous inscriptions as well as literary and legal sources reveal clear differences in the social structure of Roman slavery. There were numerous groups and professions who shared the status of being unfree while inhabiting very different worlds. The papers in this volume pose the question of whether and how legal texts reflected such social differences within the Roman servile community. Did the legal system reinscribe social differences, and if so, in what shape? Were exceptions created only in individual cases, or did the legal system generate privileges for particular groups of slaves? Did it reinforce and even promote social differentiation? All papers probe neuralgic points that are apt to challenge the homogeneous image of Roman slave law. They show that this law was a good deal more colourful than historical research has so far assumed. The authors’ primary concern is to make this legal diversity accessible to historical scholarship.
Martin Josef Schermaier Books
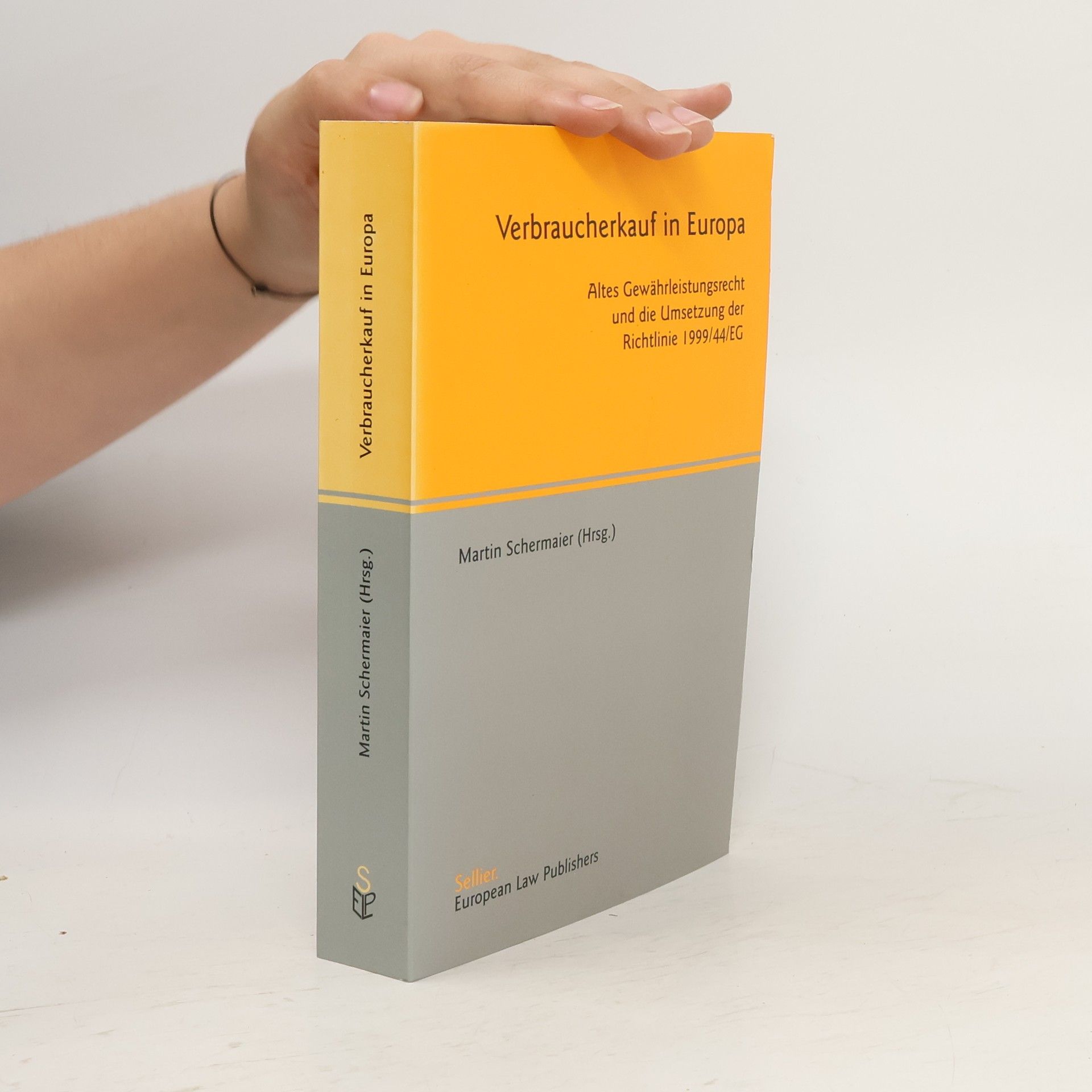

Die Richtlinie 1999/44/EG verpflichtet die Mitgliedsländer zur Angleichung eines Teils ihres nationalen Privatrechts. Der anfängliche Jubel über diesen „Meilenstein“ zur europäischen Rechtsangleichung ist schnell der Enttäuschung gewichen, da die Umsetzung in vielen Ländern bis heute unvollständig oder uneinheitlich ist. In einigen Staaten wurde die Richtlinie nicht umgesetzt, während in anderen die Umsetzung die traditionellen Gewährleistungsregeln stark beeinflusste. Der Band bietet zehn Länderberichte, die den aktuellen Stand der nationalen Gesetzgebung darstellen. Ergänzt werden diese durch sieben Beiträge, die historische, rechtspolitische und ökonomische Perspektiven zur Funktion und Dogmatik der kaufrechtlichen Sachmängelhaftung beleuchten. Eine umfassende Dokumentation des alten und neuen Gewährleistungsrechts in Europa, einschließlich Synopsen zu zwölf europäischen Kodifikationen, rundet den Band ab. Die enthaltenen Beiträge behandeln Themen wie die römischen Wurzeln der Gewährleistung, die Umsetzung der Richtlinie in verschiedenen Ländern, sowie die sprachlichen und stilistischen Aspekte der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie. Die Dokumentation umfasst die Richtlinie selbst sowie nationale Umsetzungen in mehreren Mitgliedstaaten.