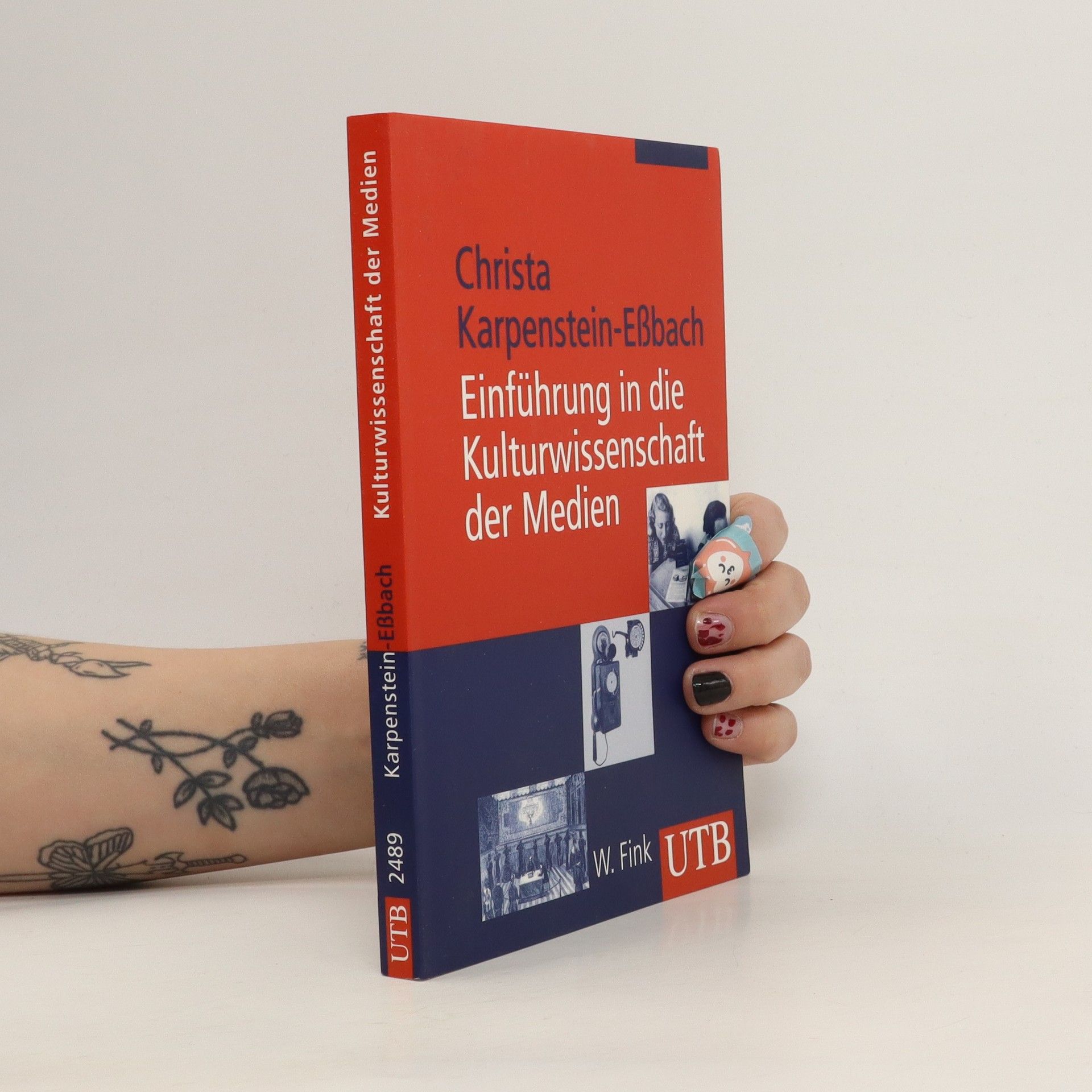Einführung in die Kulturwissenschaft der Medien
- 322 pages
- 12 hours of reading
Diese Einführung gibt einen Überblick über die zentralen Fragestellungen der Kulturwissenschaft der Medien. Medien sind mehr als bloße Instrumente für Kommunikation. Dementsprechend behandelt der Band Medien im Kontext der Sinne und Wahrnehmung, der Techniken und Apparate, der Problematik von Wirklichkeitsverhältnissen und virtuellen Welten sowie im Rahmen der Künste und medialen Wirkungspotentiale. Die Bedeutung, die Medien für die Formierung von Kultur und für die Welt- und Selbstverhältnisse der Subjekte haben, wird aus anthropologischen, technikgeschichtlichen, philosophischen und ästhetischen Perspektiven dargestellt. Ausführungen zu Einzelmedien konkretisieren die theoretischen und systematischen Grundrisse der Kultur der Medien.