Einmündung
- 157 pages
- 6 hours of reading
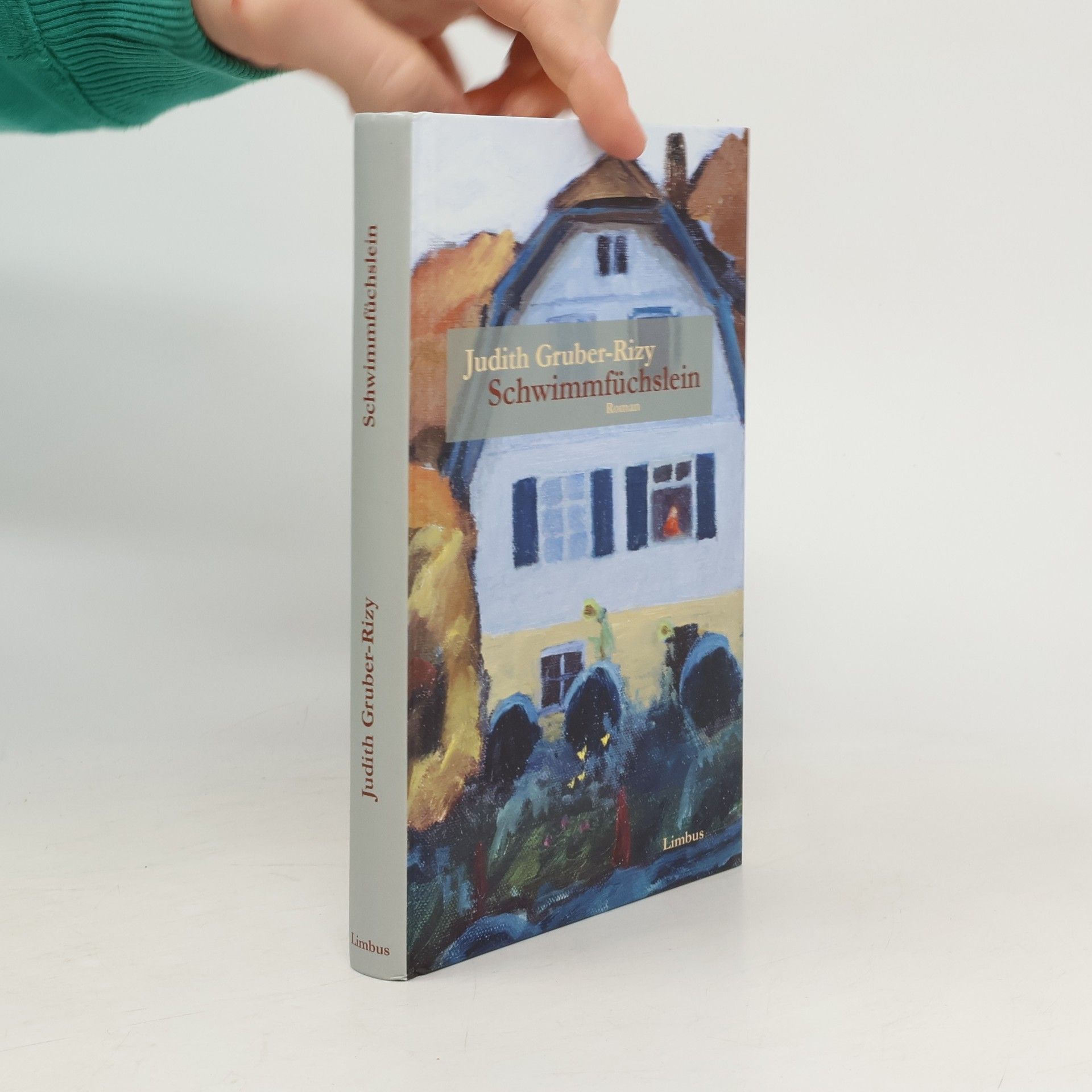
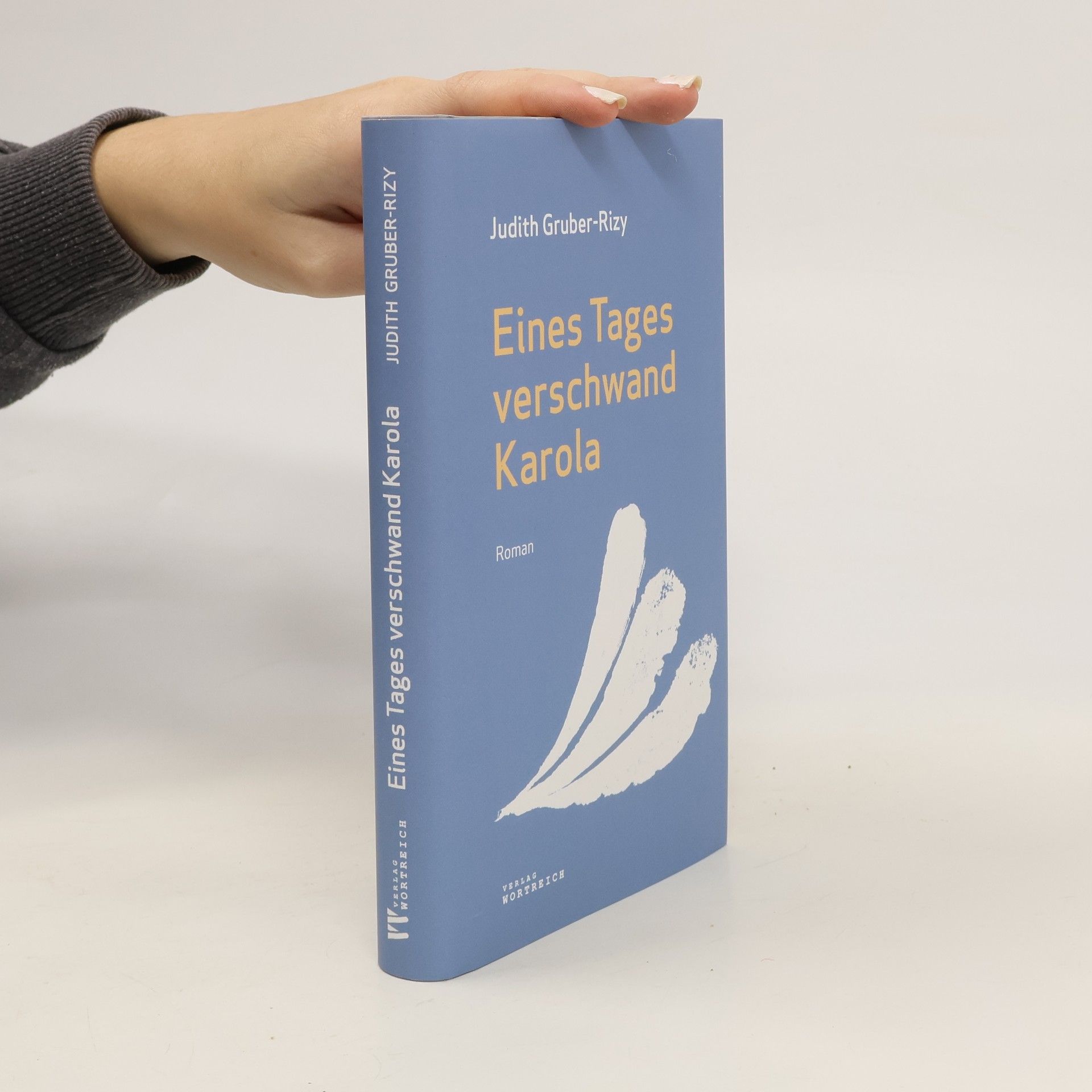

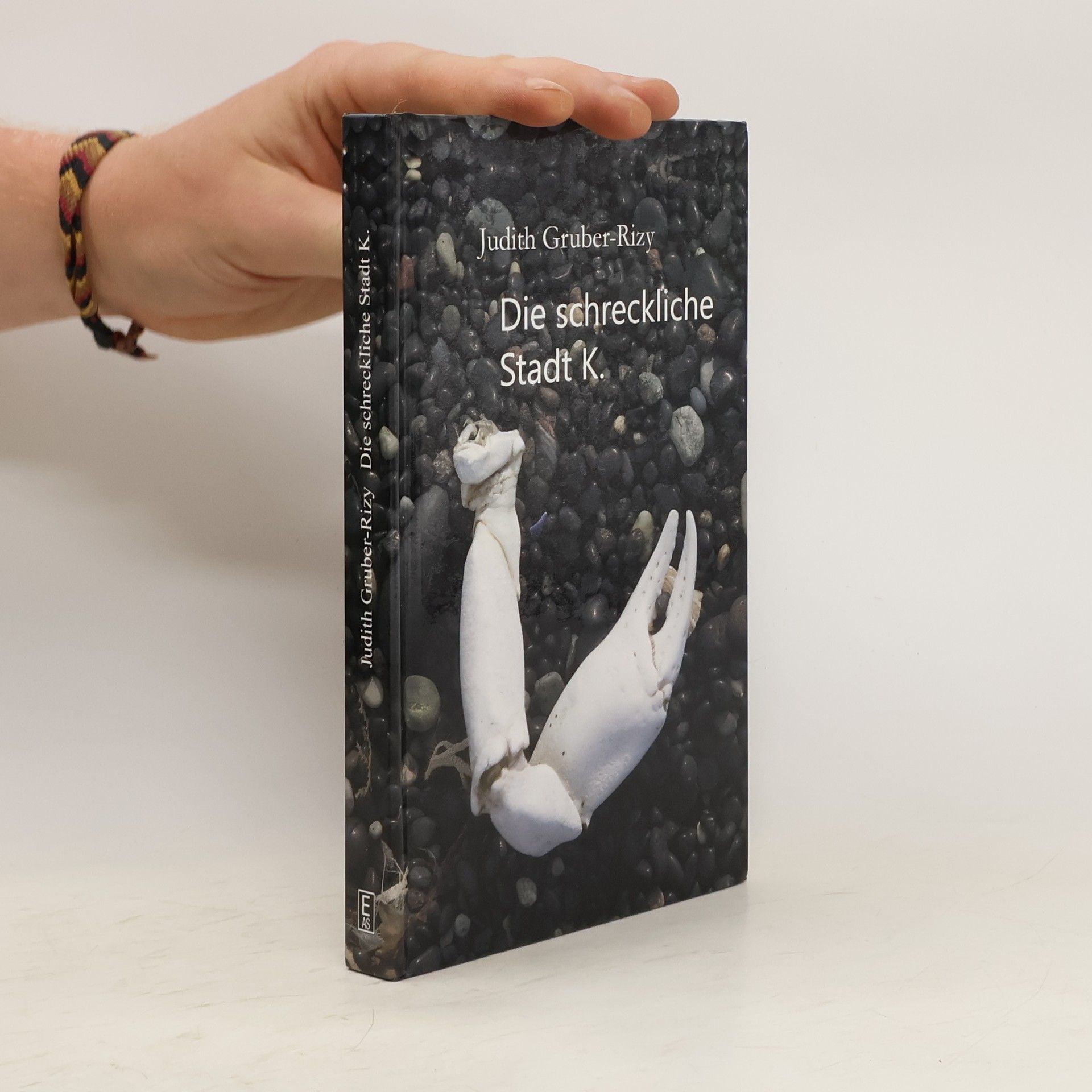
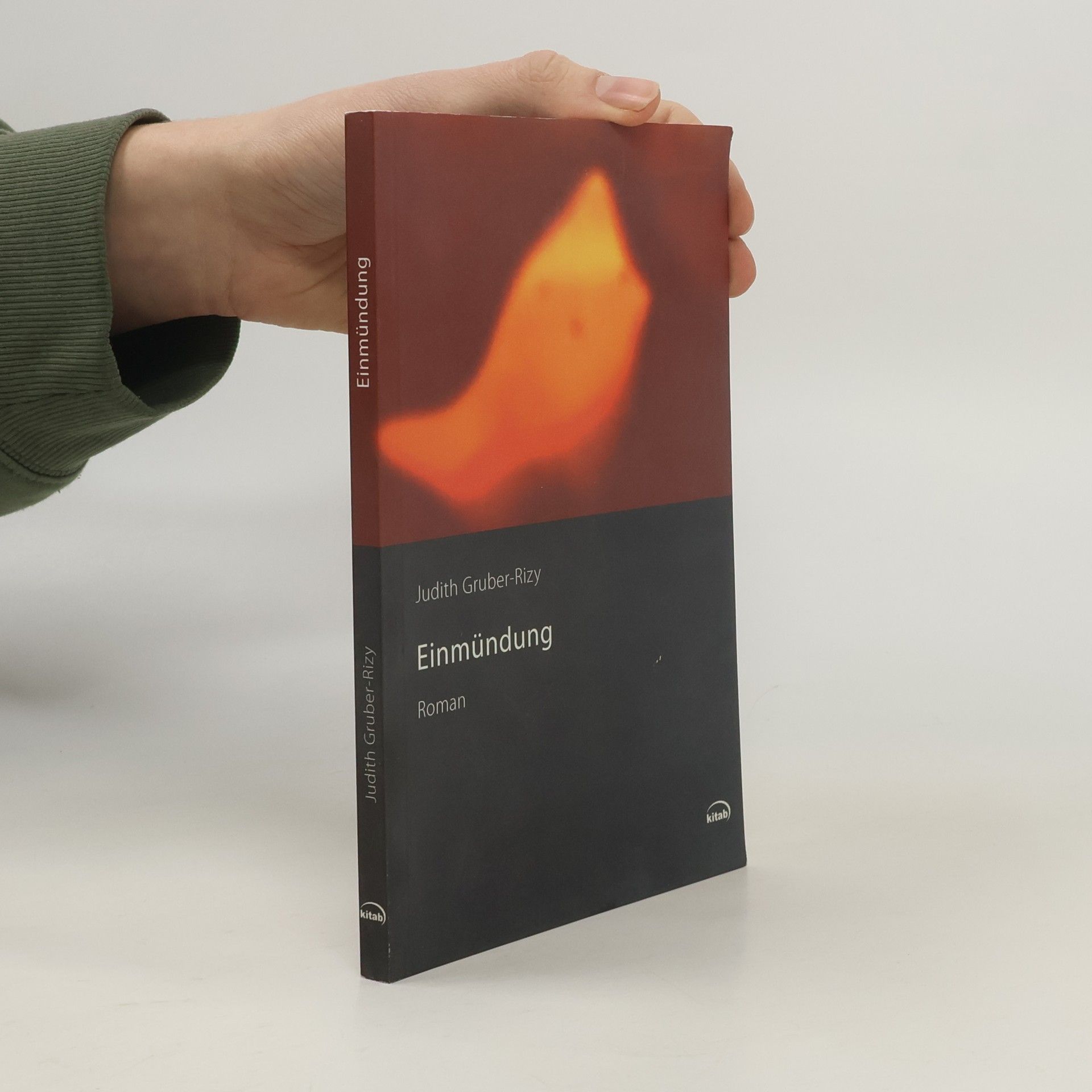
Rosa ist allein in die griechische Stadt K. zurückgekehrt, die für sie während eines Urlaubs zu einem Symbol für äußere und innere Erschütterungen geworden ist. Nun hat die Journalistin ihre Arbeit verloren und gleichzeitig ist auch die langjährige Beziehung mit ihrem Lebensgefährten in eine Krise geraten. Sie spürt sehr deutlich, dass sie an einem Wendepunkt in ihrem Leben angelangt ist.
Die Vorstellung, Stephan Stück für Stück zu vergessen, erschreckt mich. Ich habe bereits vergessen, wie sich sein Arm anfühlte, und bald werde ich seine Oberschenkel, Hände und irgendwann sogar sein Gesicht vergessen. Die Augen jedoch, die werde ich mir merken, so nehme ich mir vor. Doch ich bin mir nicht sicher. Letztlich bleibt nur das Foto, auf dem er am See sitzt, ein Schatten seiner selbst. Eine Frau, nicht mehr ganz jung und Fotokünstlerin, zieht sich ein Jahr lang aufs Land zurück, um in der Einsamkeit ein spezielles Projekt zu verwirklichen: Jeden Morgen zur gleichen Zeit will sie aus ihrem Fenster ein Foto des Kirschbaums, eines Gartenhäuschens und eines Kirchturms schießen. Ihr erwachsener Sohn David, der in der Stadt bleibt, ist ihre wichtigste Bezugsperson, während ihre Beziehungen zu anderen Menschen sporadisch und zunehmend verblassen. In ihrer intensiven Auseinandersetzung mit der physischen Außenwelt und den Veränderungen in der Natur konfrontiert sie sich mit Erinnerungen an einen Mann, den sie einst geliebt hat und dessen Geschichte sie nicht loslässt. Ein packender, sensibel und präzise geschriebener Roman, der von der Idylle der Oberflächen in die Abgründe menschlichen Daseins führt.
Eines Tages verschwand Karola und brachte damit das Leben von Rosa völlig aus dem Gleichgewicht, obwohl sich nicht sie selbst, sondern ihre Jugendfreundin Antigone auf die Suche nach Karola machte. Diese drei Frauen, damals Ende dreißig, waren jede für sich an einem Punkt ihres Lebens angelangt, an dem sie hofften - oder wie Karola daran verzweifelten - noch einmal neu anfangen und ihrem Leben eine neue Richtung geben zu können. Ein Vierteljahrhundert später erzählt Rosa die Geschichte von der Suche nach Karola ihrer neuen Freundin Anne. Rosa ist inzwischen in den Sechzigern und kann so manches aus ihrem Leben in der Zeit mit Karola und Antigone nur mehr schwer nachvollziehen. Gemeinsam mit Anne, einer Literatur-Übersetzerin, analysiert sie nun die Beweggründe der damals Enddreißigerinnen.
„Schwimmfüchslein“ nannte Wassily Kandinsky die Malerin Gabriele Münter am Beginn ihrer Beziehung liebevoll. Doch er ertrug es nicht, dass seine Lebensgefährtin als Künstlerin ihren eigenen Weg gehen wollte. Rosa entdeckt auf einer Zugreise ein liegengelassenes Buch, eine Biografie über Gabriele Münter. Rosa, selbst Künstlerin, fühlt sich bald mit dem „Schwimmfüchslein” verwandt – auch sie leidet unter der Nichtbeachtung ihrer Kunst durch den Partner. „Die Kunst wird den Frauen nicht zugestanden“, muss Rosa feststellen. Ein Roman über zwei Künstlerinnen im Ringen um Anerkennung.