Kindheit und Familie sind Themen, die Menschen seit jeher bewegen. Doch wie genau dachten die Menschen früher darüber? Gab es im Mittelalter überhaupt eine Kindheit, oder waren Kinder eher kleine Erwachsene, die ihren Beitrag für die Familie leisten und oftmals schon früh arbeiten mußten? Hatten uneheliche oder behinderte Kinder eine Chance auf ein Leben in der Gesellschaft, oder mußten sie ihr Leben als Außenseiter fristen? Welche Spiele spielten Kinder früher ? Welche Strafen standen auf Kindsmord, und welche Möglichkeiten der Familienplanung gab es in einer Zeit ohne moderne Maßnahmen zur Empfängnisverhütung? Diese und andere Fragen stellt und beantwortet Frank Meier in seinem Buch und belegt sie anschaulich und unterhaltsam anhand von historischen und literarischen Quellen. ● eine längst fällige, aktuelle Geschichte der Kindheit und Familie ● ein aktuelles Thema ● Geschichte anschaulich erzählt
Frank Meier Books



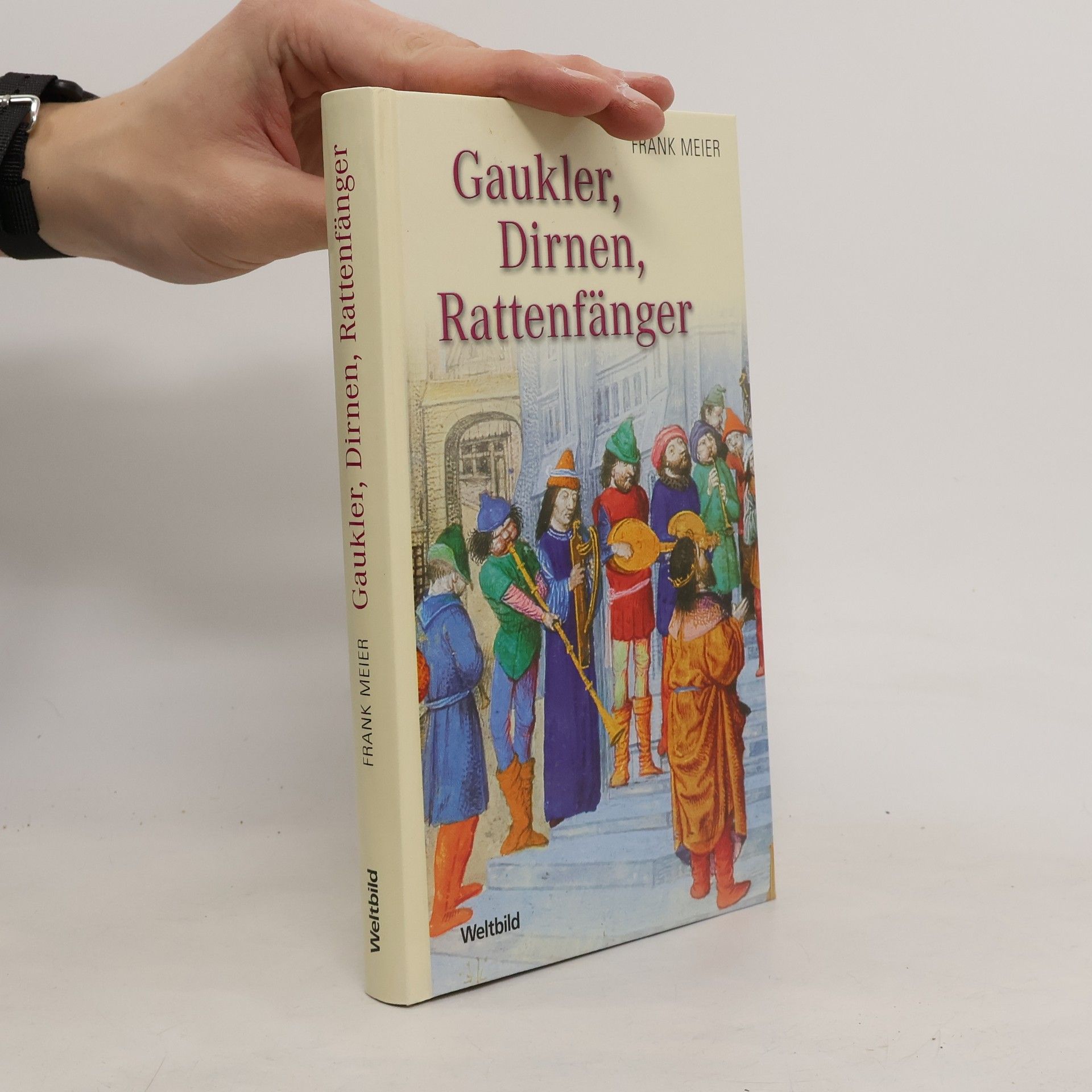


Gefürchtet und bestaunt
- 176 pages
- 7 hours of reading
„Fremd ist jeder in der Fremde“ – sagt ein Sprichwort. Doch was bedeutet Fremdheit eigentlich – und wo beginnt die Fremde? Frank Meier spürt den verschiedenen Aspekten des Fremdseins im Mittelalter nach. Er berichtet von der Bedrohung durch fremde Völker wie etwa den Hunnen, aber auch von der friedlichen Expedition Marco Polos nach China. Daneben thematisiert er jedoch auch das Phänomen der Fremdheit innerhalb der Gesellschaft, das etwa Juden und Ketzer aufgrund ihres anderen Glaubens traf oder Spielleuten und Gauklern aufgrund ihres Standes und ihrer Profession. Er erzählt davon, dass selbst der eigene Mann oder die eigene Frau aufgrund der Geschlechterdifferenz als Fremde empfunden werden konnten und wie man mit Homosexuellen umging. Der Umgang mit dem Fremden im Mittelalter erhält dadurch eine Aktualität, die zeigt, dass uns mittelalterliche Denkweisen auch heute noch gar nicht so „fremd“ sind.
Gaukler, Dirnen, Rattenfänger
- 190 pages
- 7 hours of reading
Fachbegriffe der EMV
Elektromagnetische Verträglichkeit zum Nachschlagen für Studenten, Berufsanfänger und Einsteiger
- 180 pages
- 7 hours of reading
Das Buch bietet eine umfassende Darstellung der Fachbegriffe der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Es erläutert eng verwandte Begriffe anschaulich und verständlich, ergänzt durch Quellen und Verweise. Zudem werden englische Übersetzungen bereitgestellt, um den Zugang zur angelsächsischen Literatur zu erleichtern. Die Auswahl der Begriffe orientiert sich an den Bedürfnissen des technisch-wissenschaftlichen Sektors und dient als wertvolle Ressource für Fachleute und Studierende.
Extremismus, Fundamentalismus, Terrorismus – eine der größten Gefahren unserer Zeit ist religiöser Fanatismus. Frank Meier berichtet von religiösen Fanatikern von der Antike bis zur Frühen Neuzeit, von Geißlern, Kreuzrittern, Inquisitoren und Assassinen. Er erzählt, was diese Menschen glaubten, was sie bewegte und warum ihr Glaube sie zu extremen Handlungen trieb. Zahlreiche historische Quellen und farbige Abbildungen zeichnen ein lebendiges Bild der Vergangenheit und schärfen den Blick für aktuelle Fragestellungen. · Ein brisantes Thema und seine Wurzeln in der Geschichte · Spannend, faktenreich, historisch belegt
Organisationen spielen für viele Bewertungsprozesse eine entscheidende, aber oft übersehene Rolle: Sie geben den Kontext ab, in dem Bewertungen vollzogen werden, sie produzieren und kommunizieren Bewertungen und werden schließlich auch selbst regelmäßig bewertet, evaluiert, geratet und gerankt. Die Beiträge des Bandes verknüpfen systematisch Ansätze aus Organisationsforschung und Valuation Studies und eröffnen dadurch einen dezidiert organisationssoziologischen Blick auf Phänomene des Bewertens, Vermessens, Kategorisierens und Vergleichens in, von und durch Organisationen.
Gewalt und Gefangenschaft im Mittelalter
- 310 pages
- 11 hours of reading