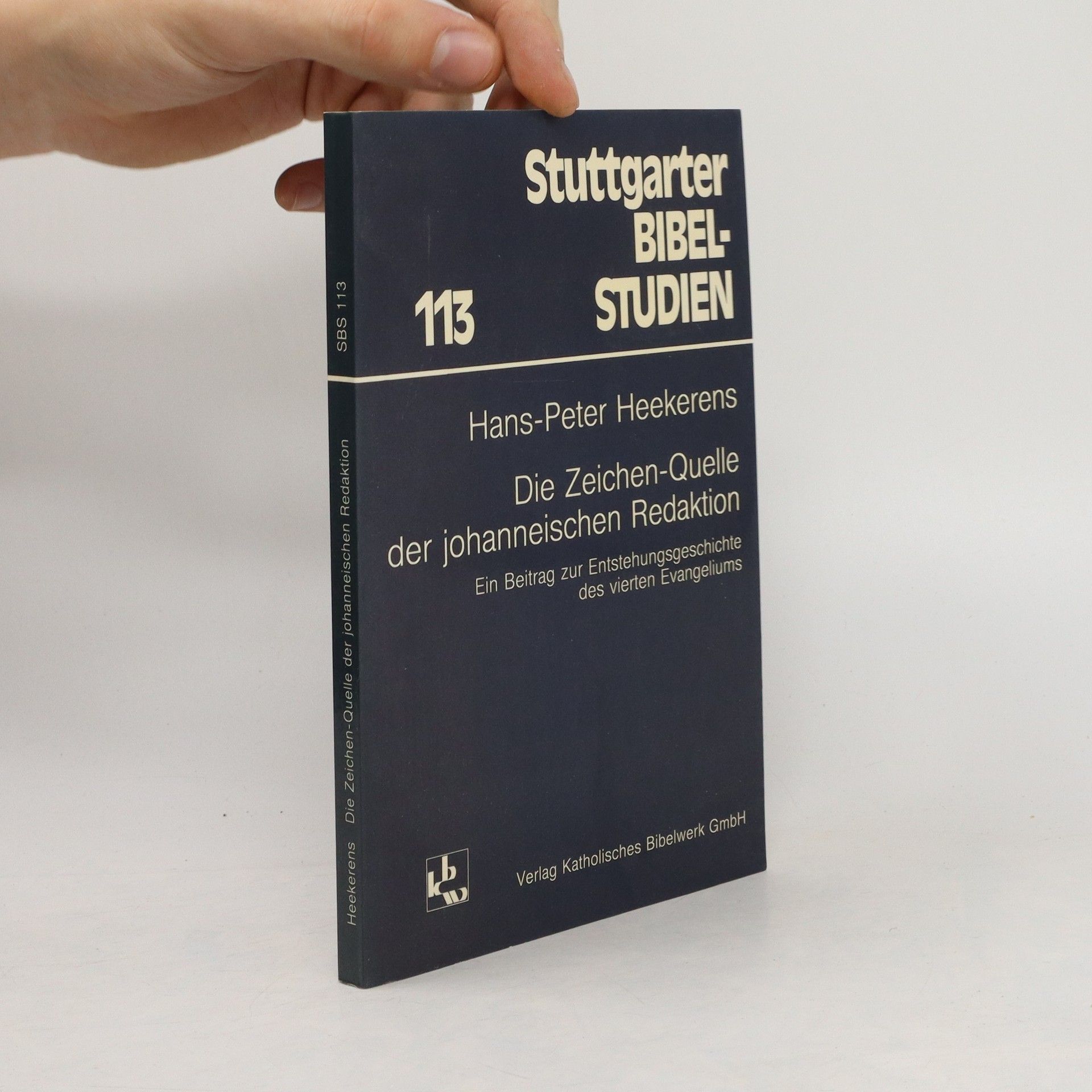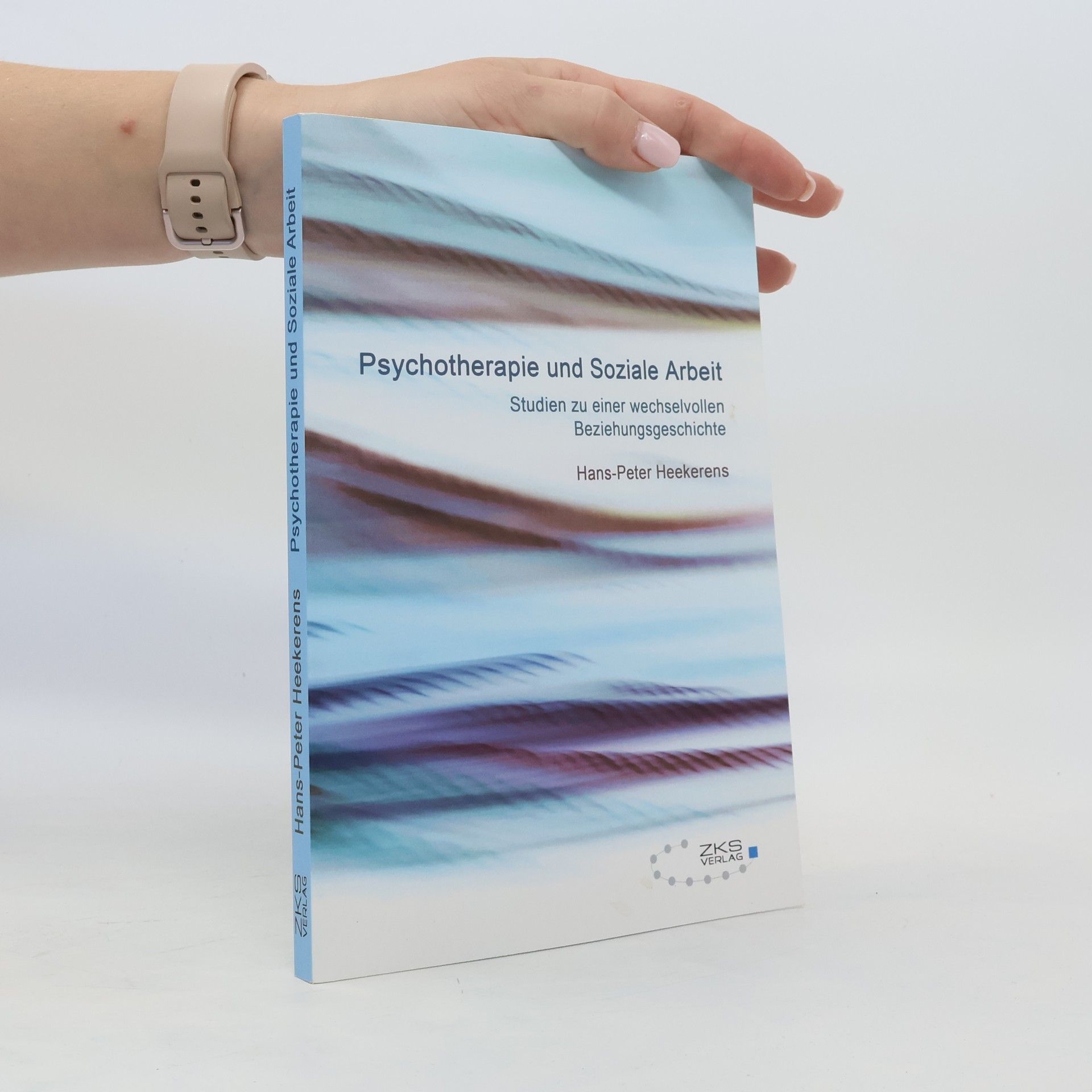Psychotherapie und Soziale Arbeit
Studien zu einer wechselvollen Beziehungsgeschichte
Soziale Arbeit und Psychotherapie sind organisierte Hilfen zur Linderung menschlichen Leidens, die eine lange Tradition und über hundertjährige Geschichte teilen. Diese beiden Disziplinen haben sich gegenseitig beeinflusst, wobei ihre Beziehung von professionellen Interessen und relevanten Kontexten geprägt ist. Eine umfassende Geschichte dieser Wechselbeziehung steht noch aus. Die sechs Studien in diesem Buch dienen als Puzzlestücke für ein zukünftiges Gesamtbild und beleuchten Aspekte, die oft im Dunkeln liegen. Die ersten drei Beiträge konzentrieren sich auf die USA vor dem Krieg und die Anfänge der Klinischen Sozialarbeit. Sie zeigen, wie psychodynamisches Denken und der "funktionale Ansatz" der Einzelfallhilfe ein frühes Modell der Klinischen Sozialarbeit prägten und wie die Interaktion von Psychiatrie, Sozialarbeit und Psychotherapie zu einer frühen Form der Familientherapie führte – alles beeinflusst von Otto Rank, einem Schüler Freuds und späteren Dissidenten. Die letzten drei Beiträge betrachten die Entwicklung in Deutschland bis zur Gegenwart, einschließlich der aufsuchenden Familientherapie, der Geschichte der Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen und einer Übersicht zur Evaluation psychosozialer Interventionen.