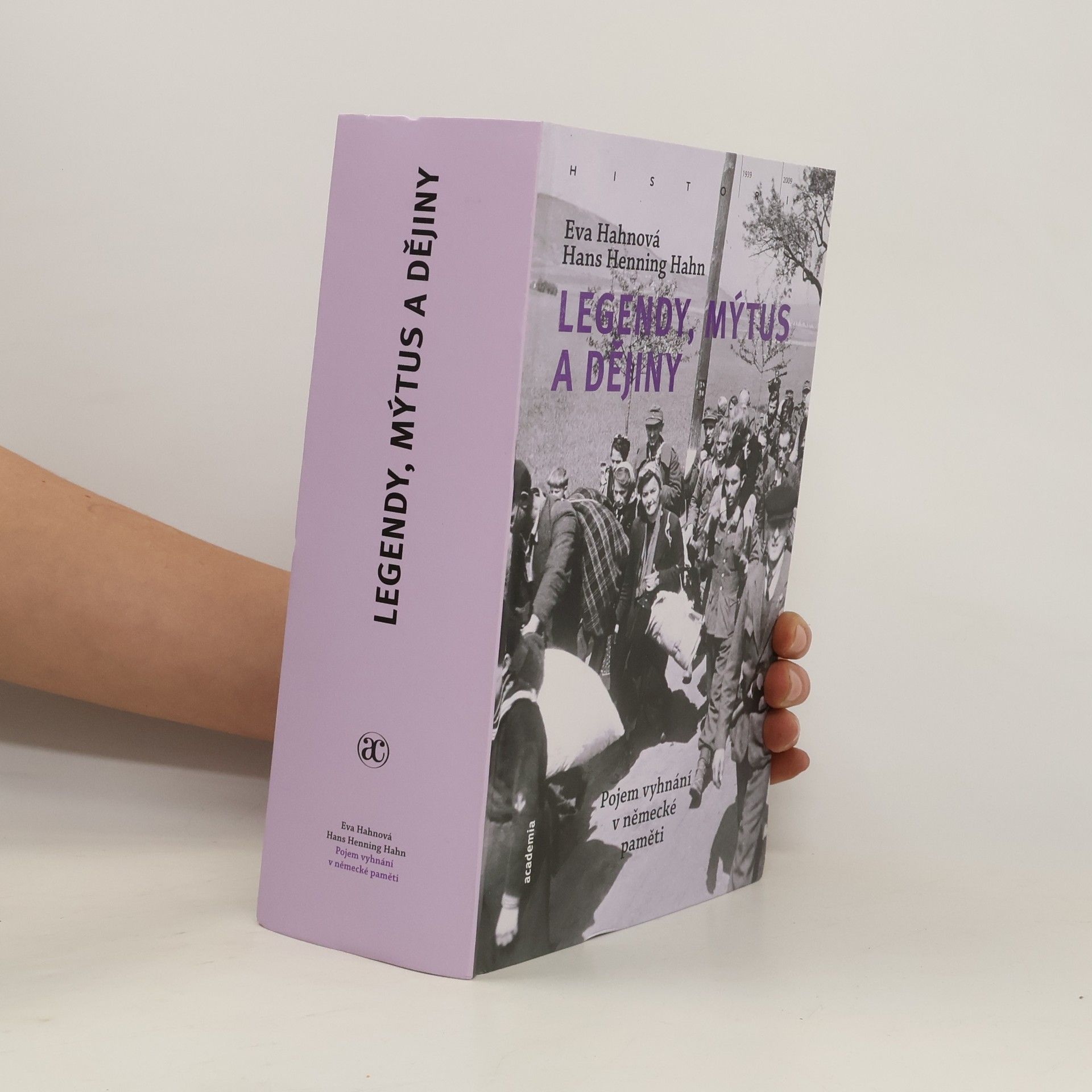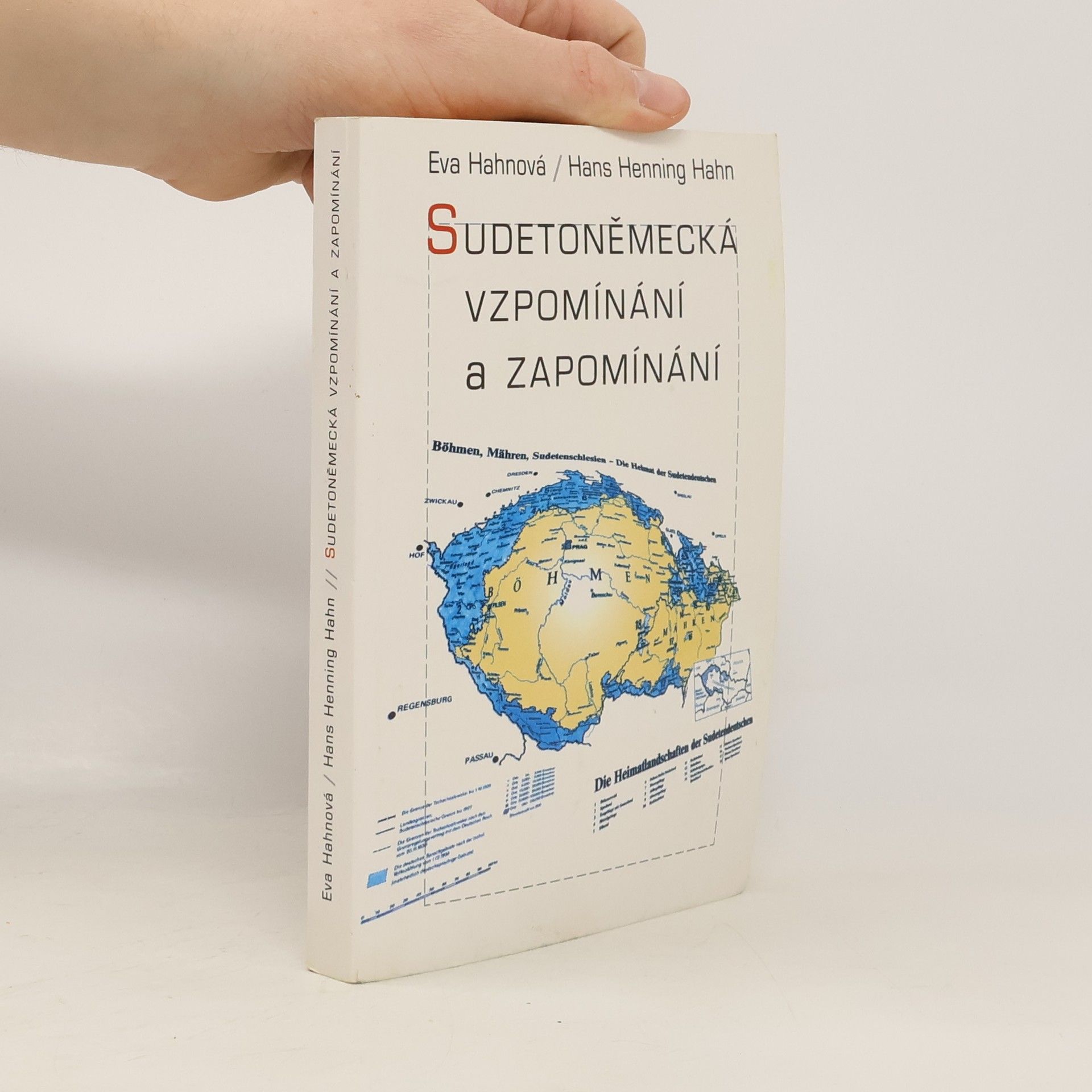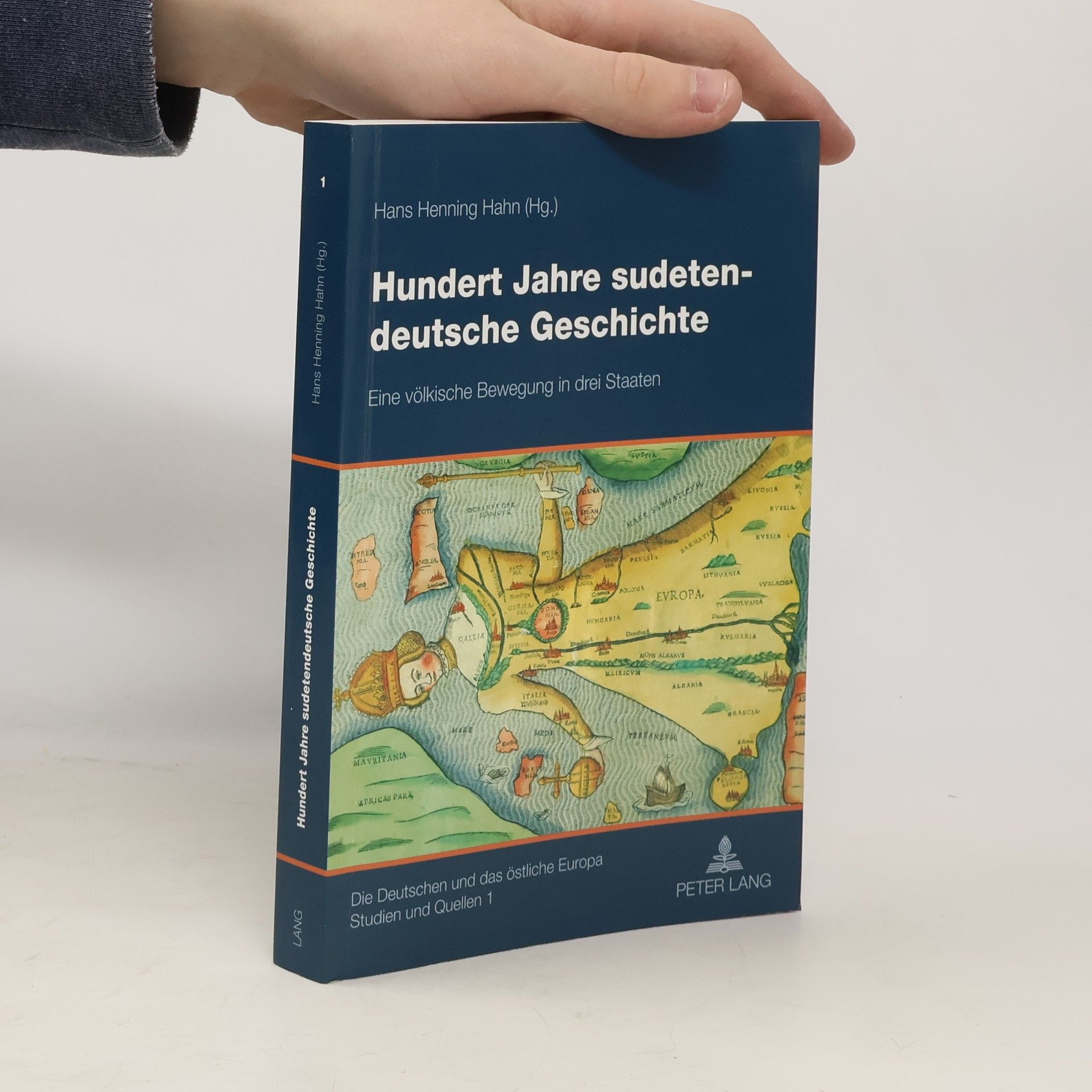Stereotyp, Identität und Geschichte
- 440 pages
- 16 hours of reading
Stereotypen sind in allen Gesellschaften zentrale Bestandteile jeglicher Kommunikation im Alltag, in der Politik, Presse, Bildung und anderen Bereichen des öffentlichen Diskurses. In diesem Band werden Ansätze einer neuen kulturwissenschaftlichen Stereotypenforschung entwickelt. Historiker, Slawisten, Linguisten, Volkskundler und Kunsthistoriker aus Deutschland, Polen, der Slowakei und Tschechien behandeln Formen und Funktionen von Stereotypen in unterschiedlichen Zusammenhängen in zwischennationalen Beziehungen, im innergesellschaftlichen Raum, bei nationaler Identitätsbildung, in literarischen Texten und folkloristischen Quellen, für die Geschichtsdidaktik, in der NS-Propaganda u.ä. Die Interdependenz von Fremd- und Selbstbildern spielt in den methodischen Überlegungen und empirischen Untersuchungen eine maßgebliche Rolle.