Klaus Kanzog Books
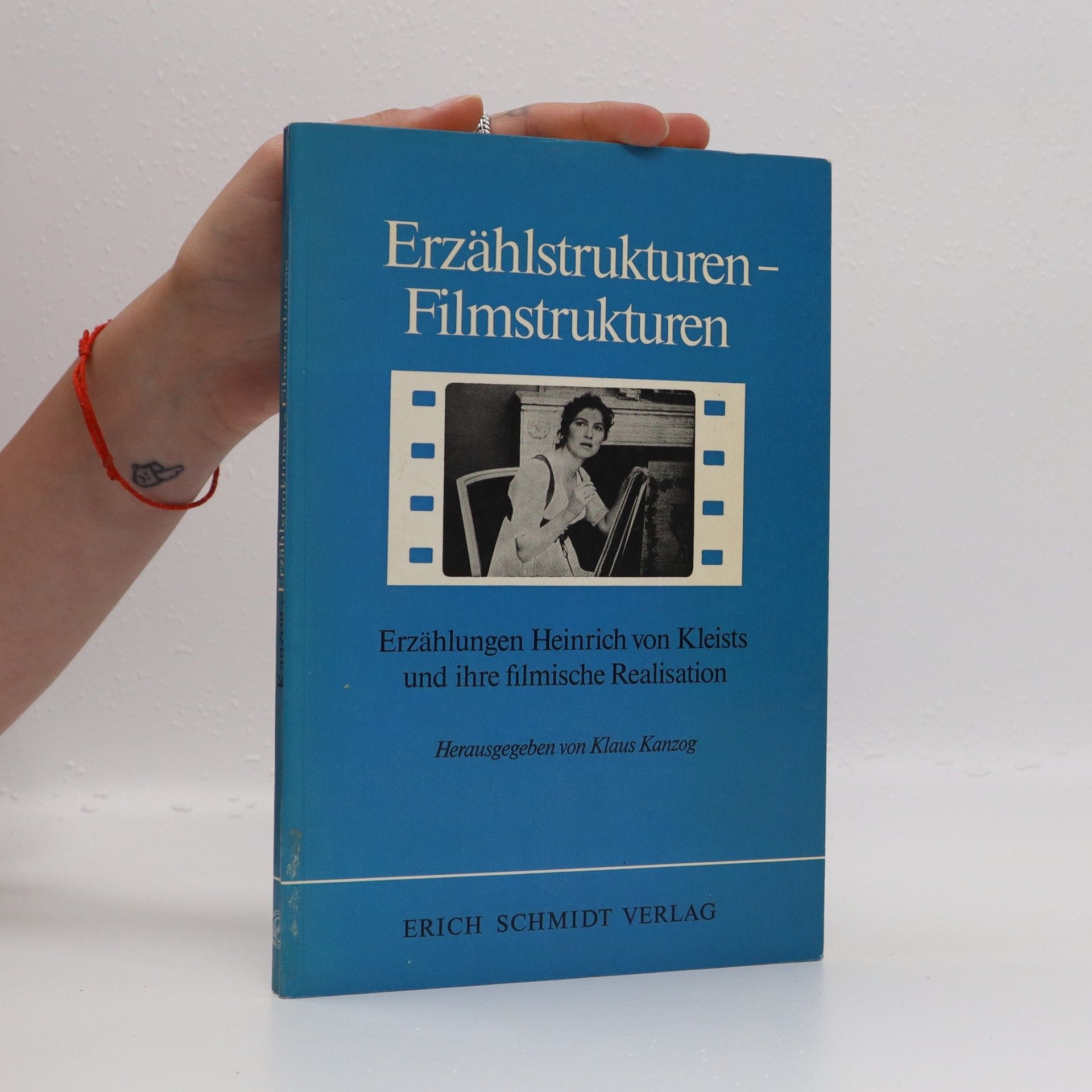
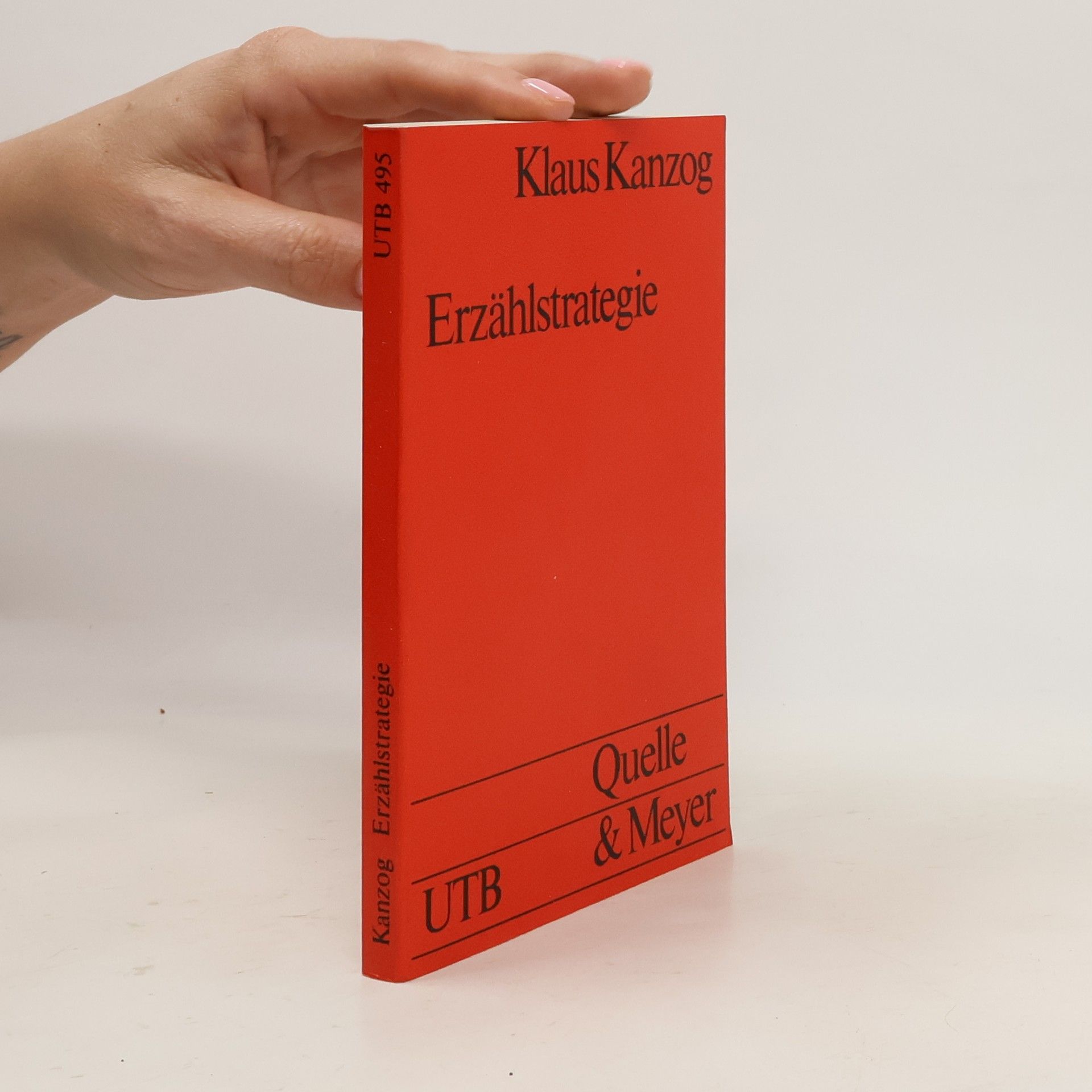
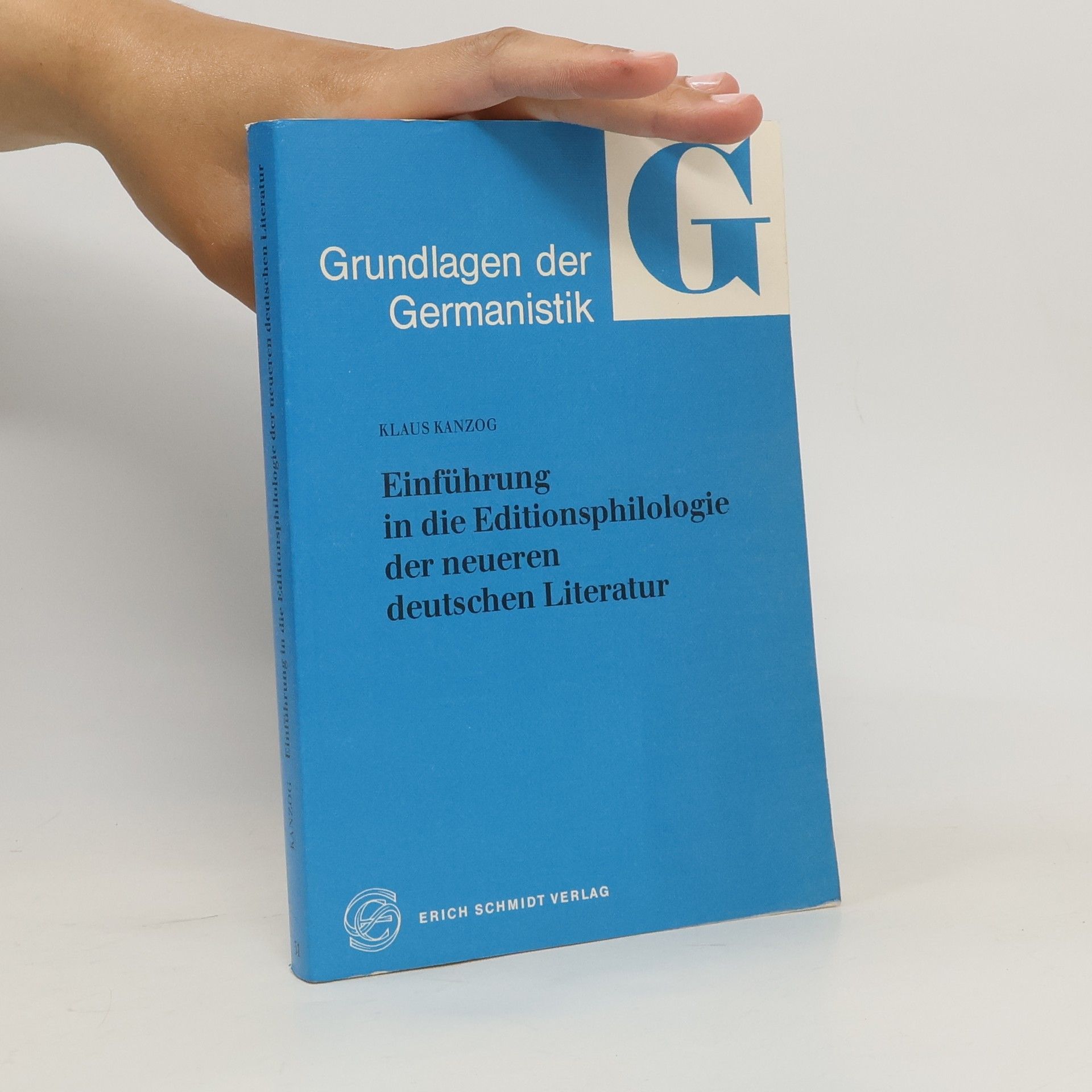
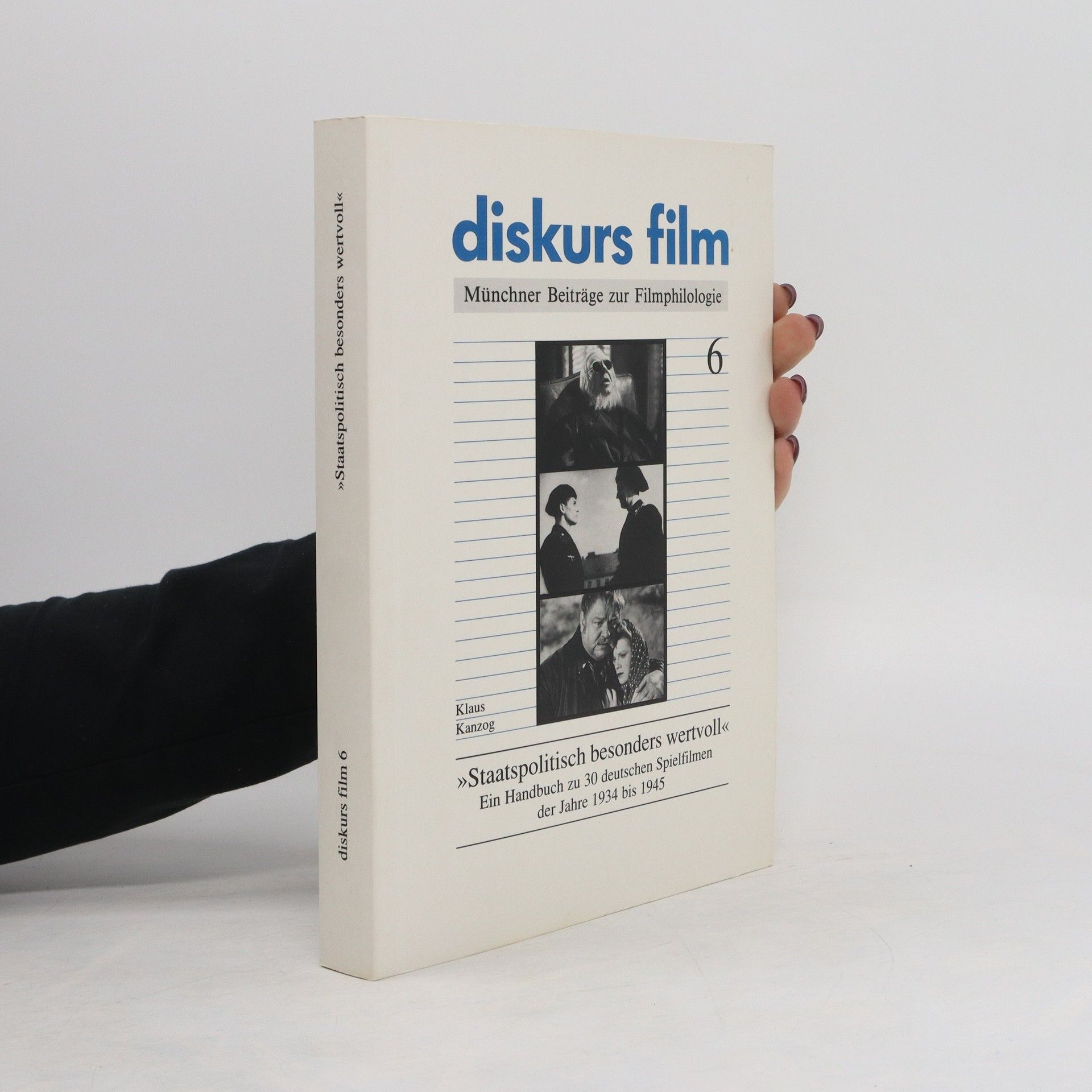

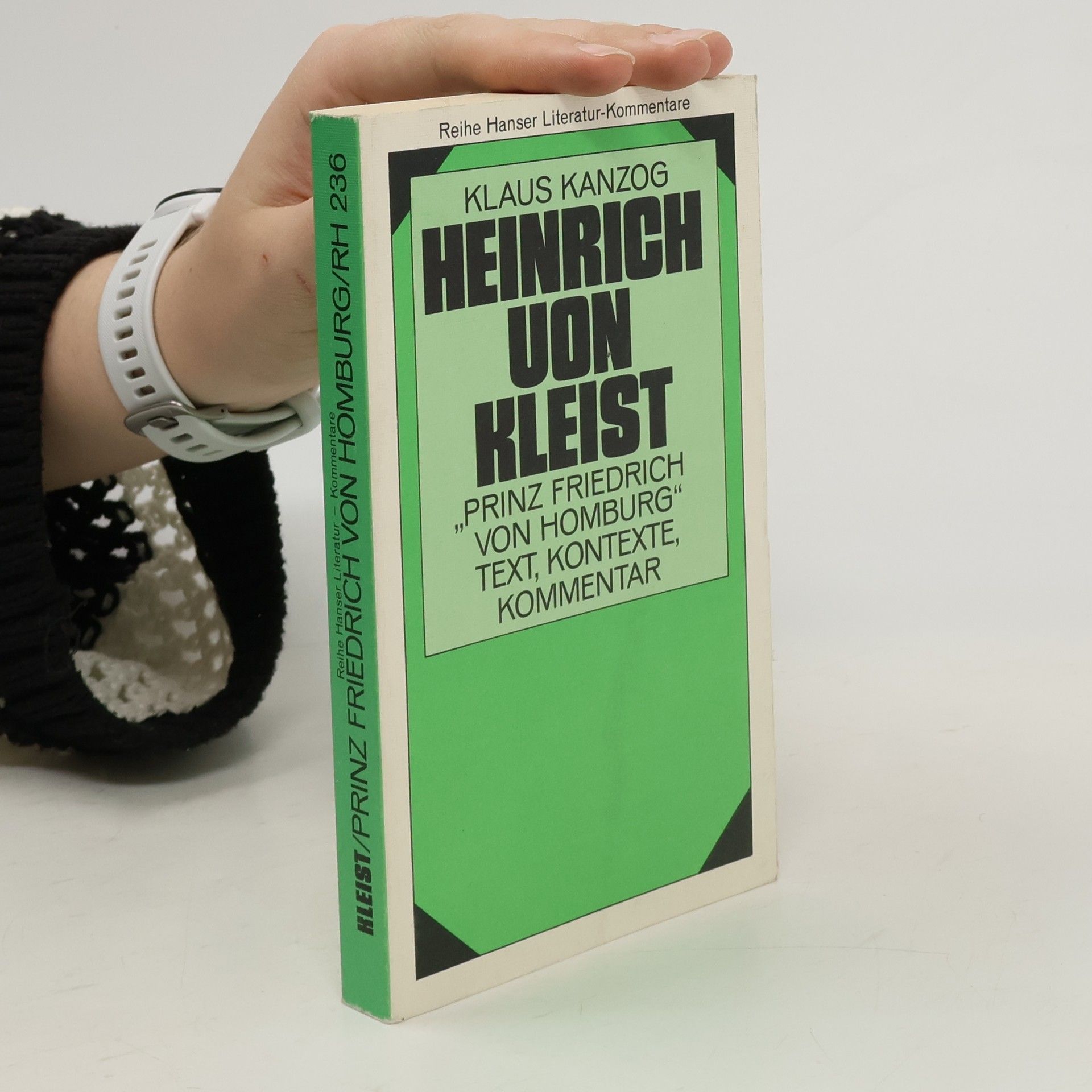
E. T. A. Hoffmann und Heinrich von Kleist
Textbeobachtungen - Spurenelemente
- 158 pages
- 6 hours of reading
Die Untersuchung beleuchtet die literarischen Verbindungen zwischen Kleist und E. T. A. Hoffmann, insbesondere die wechselseitigen Einflüsse, die über die traditionelle Einflußphilologie hinausgehen. Im Fokus steht die Idee des »poetischen Somnambulismus«, den Hoffmann in Werken wie Kleists Käthchen von Heilbronn und Shakespeares Romeo und Julia erkennt. Zudem wird auf die gesellschaftliche Rolle beider Autoren eingegangen, die sich für Rechtssicherheit und demokratische Werte einsetzten. Die Analyse zeigt, wie Hoffmann und Kleist durch ihre Texte zur Resozialisierung und der moralischen Entwicklung des Volkes beitrugen.
Die 30 deutschen Spielfilme, die zwischen 1934 und 1945 das Prädikat „staatspolitisch besonders wertvoll“ erhielten, werden hier erstmals umfassend betrachtet und detailliert beschrieben. Dieses Handbuch ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Filmwissenschaftler, Historiker und Cinéasten, die sich über Produktions- und Zensurdaten, Inhalte sowie literarische Vorlagen dieser Filme zur Zeit ihrer Uraufführung informieren möchten. Der Hauptteil präsentiert die einzelnen Filme mit ausführlichen Handlungsabläufen, zentralen Normaspekten und markanten Textbeispielen; zahlreiche Abbildungen verweisen auf Schlüsselbilder und Topoi. Die Einleitung thematisiert die Problematik des Filmprädikats, während Dokumente und Übersichtsgraphiken im Anhang die filmpolitischen Bezüge von der Weimarer Republik bis heute verdeutlichen. Von den 30 Filmen unterliegen heute nur noch neun dem Aufführungsvorbehalt. Der Band richtet den Fokus nicht nur auf das Staatsbewusstsein zur Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft, sondern reflektiert auch aktuelle Fragen der filmischen Normvermittlung. Das Buch bietet eine solide Grundlage für weitere Forschungen und wird als anregendes Lesebuch sowie unverzichtbares Arbeitsmittel angesehen.
Einführung in die Editionsphilologie der neueren deutschen Literatur
- 231 pages
- 9 hours of reading
Kanzog hat eine Anleitung zum kritischen Umgang mit Textüberlieferungen und Editionen konzipiert, die aus einem hermetischen Gedankenaustausch der Fachleute herausführen soll. Mit Hilfe ausgewählter Beispiele, die im akademischen Unterricht zum Lehrkanon gehören und in besonderem Maße merkfähig sind, soll der Leser den Weg zu einem besseren Verständnis der Überlieferungszusammenhänge von Texten finden, zentrale Phänomene der Textüberlieferung und Textkonstitution erkennen und sich zugleich die Kriterien maßgebender Editoren vor Augen führen. Im Vordergrund steht nicht eine Dogmenlehre der Editorik, sondern die Vermittlung von Standpunkten, und es wird jene Linie verfolgt, auf der sich unter den Editoren ein Konsens in grundsätzlichen Fragen abzuzeichnen beginnt. Dabei wird gelegentlich die Grenze zu anderen Fachgebieten überschritten und so der interdisziplinäre Charakter der Editionswissenschaft unterstrichen.
Erzählstrategie
- 204 pages
- 8 hours of reading
Erzählstrukturen - Filmstrukturen : Erzählungen Heinrich von Kleists und ihre filmische Realisation
- 172 pages
- 7 hours of reading
6 Bildseiten, mit insgesamt 12 Abbildungen, 7 Grafiken und 32 Tabellenseiten
Diskurs Film - 4: Einführung in die Filmphilologie
Münchner Beiträge zur Filmphilologie - 2. Auflage
- 246 pages
- 9 hours of reading
Filmphilologie behandelt die terminologischen Herausforderungen der angemessenen Analyse von Film und bildet die Grundlage für die Filmanalyse. Die Einführung in dieses Fachgebiet beleuchtet die Kommunizierbarkeit audiovisueller Medien und setzt dabei drei Schwerpunkte. Im Kapitel „Grundsatzfragen“ werden verschiedene methodische Ansätze sowie terminologische Aspekte wie Zeichen- und Textstatus, Handlung, Perspektive und mise en scène erörtert. Das zweite Kapitel „Erkenntniswege“ demonstriert anhand konkreter Filmbeispiele die einzelnen Schritte und fasst diese zu spezifischen Vorgehensweisen zusammen. Im Kapitel „Kommunikation“ wird ein kritischer Überblick über die unterschiedlichen Protokollierungsverfahren gegeben, die in der Medienwissenschaft entwickelt wurden. Leser erhalten Einblicke in den aktuellen Forschungsstand sowie Vorgaben für weiterführende Analysen von Filmen. Zudem gibt es gezielte Lektüreempfehlungen, die zur vertieften Auseinandersetzung mit den Themen anregen. Der Anhang enthält eine Diskussion spezifischer Notationssysteme sowie ein Beschreibungsinventar für audiovisuelle Medien. Ein abschließender Abschnitt über die Verbindungen zwischen Filmphilologie und Psychologie rundet diese aktualisierte und erweiterte Auflage ab.
