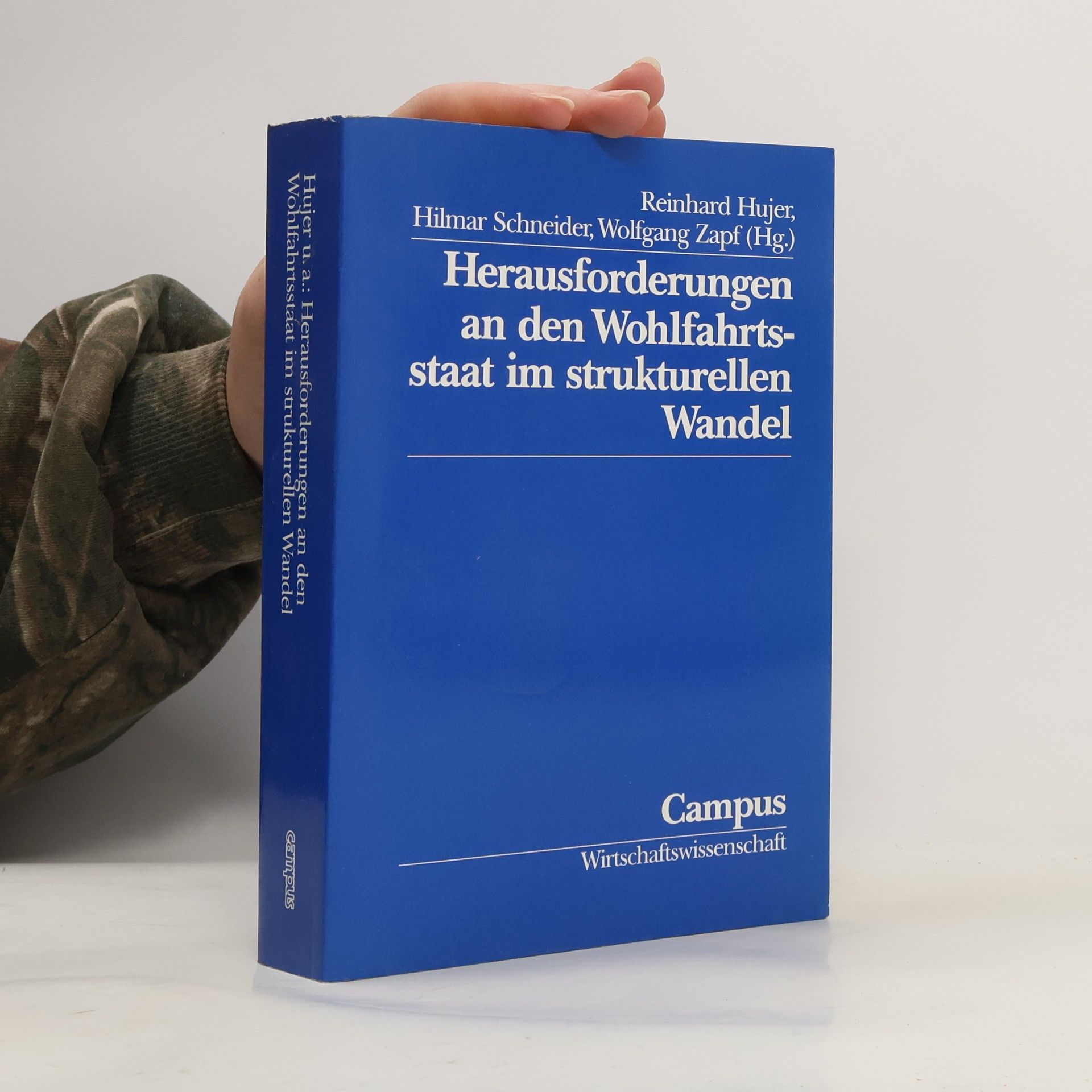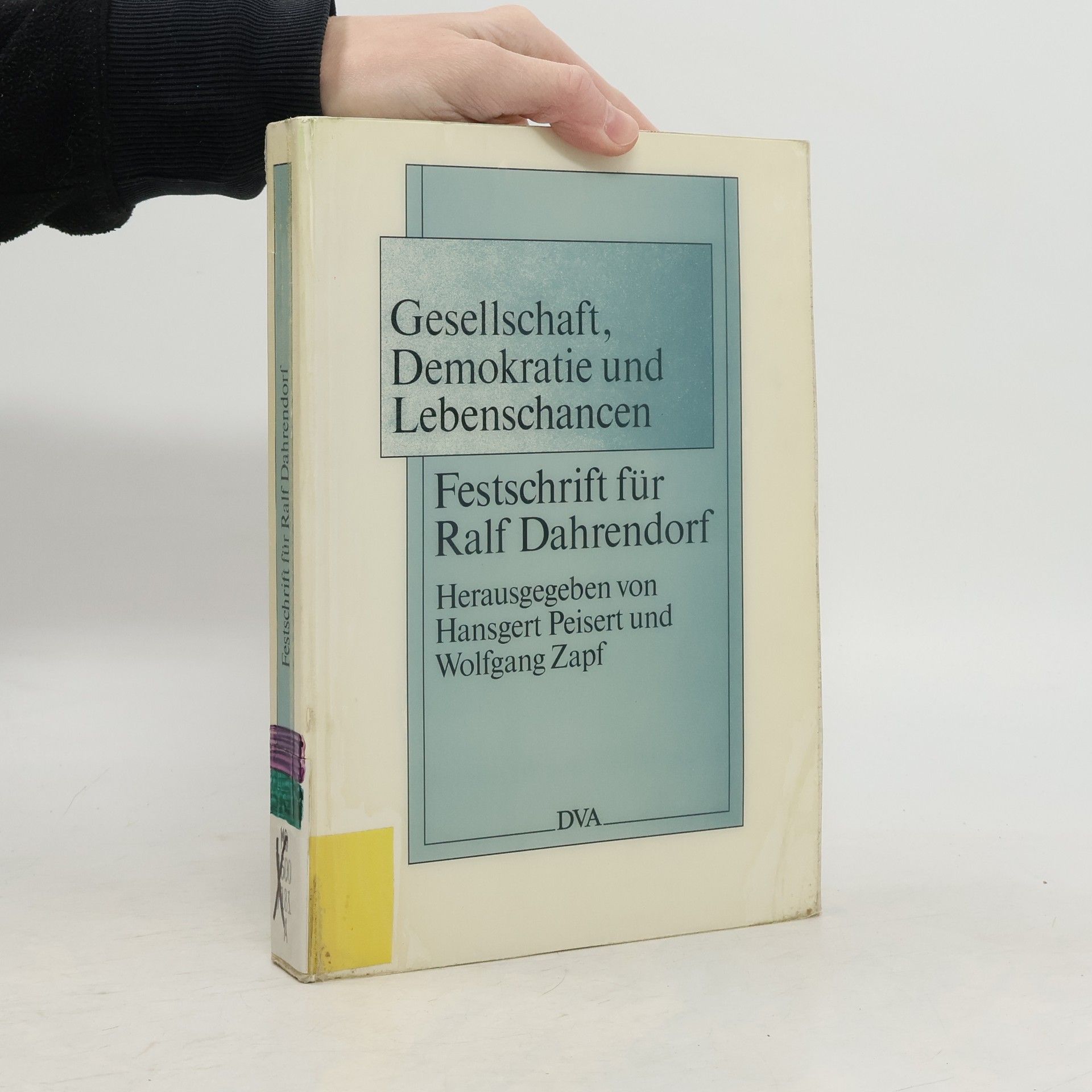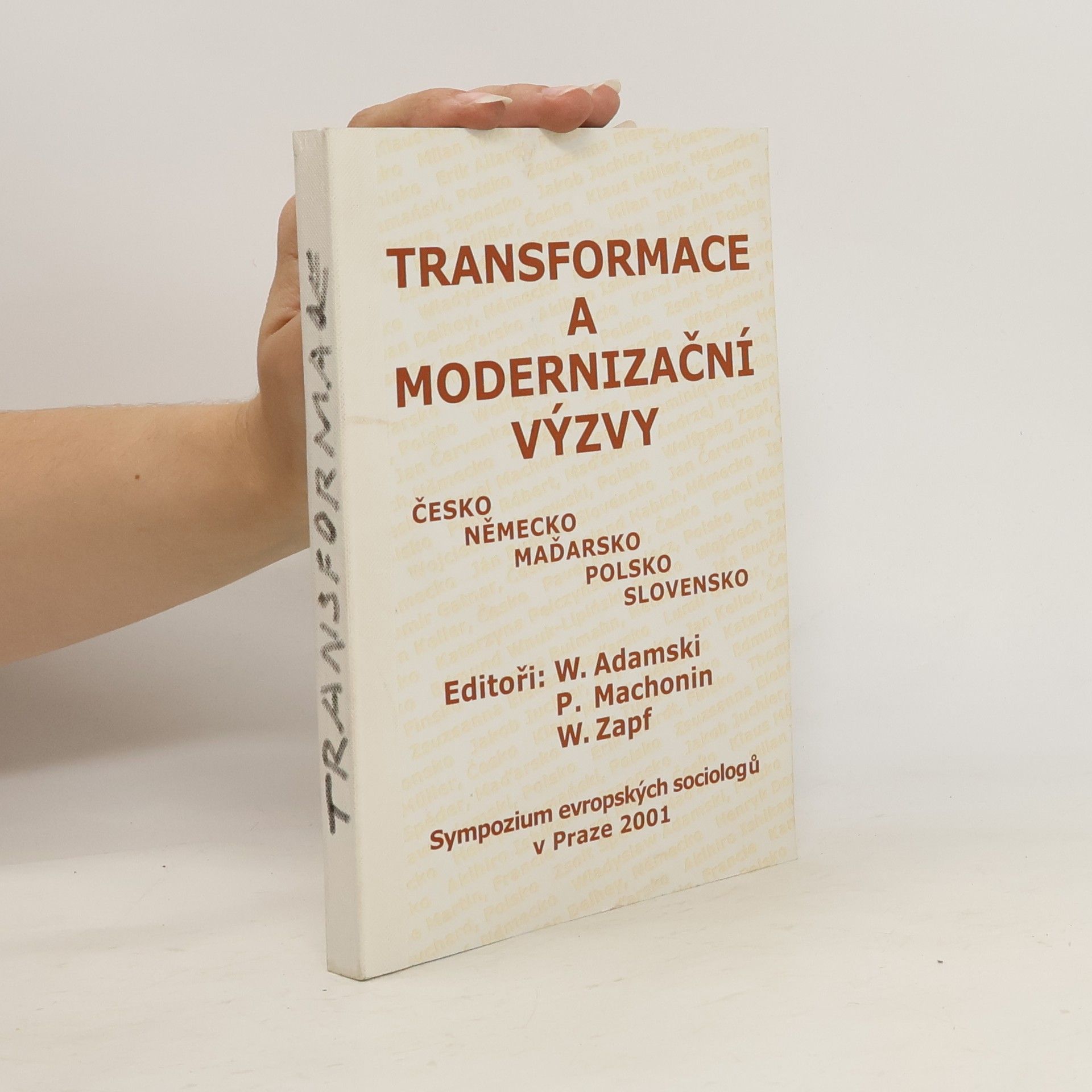Wolfgang Zapf Books

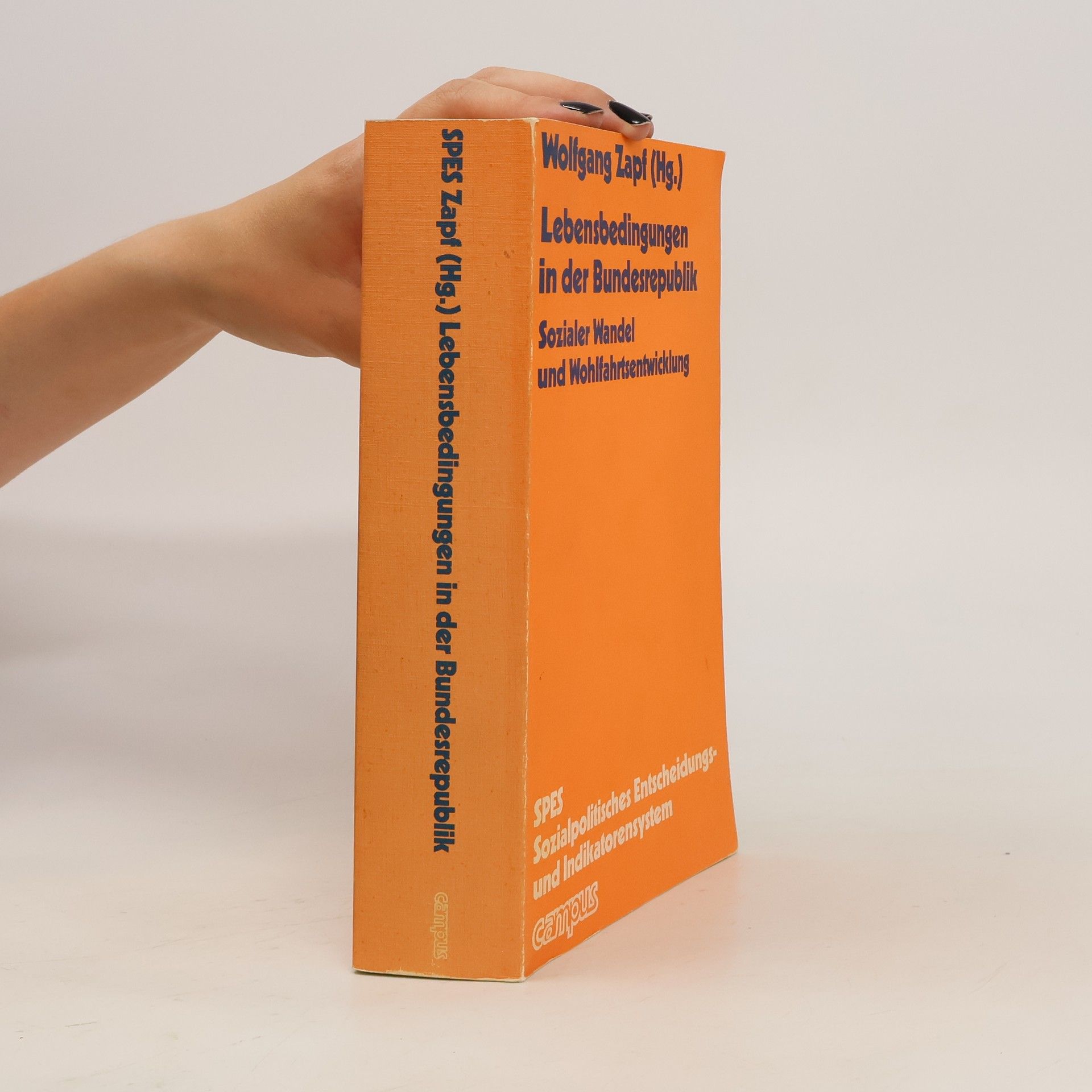
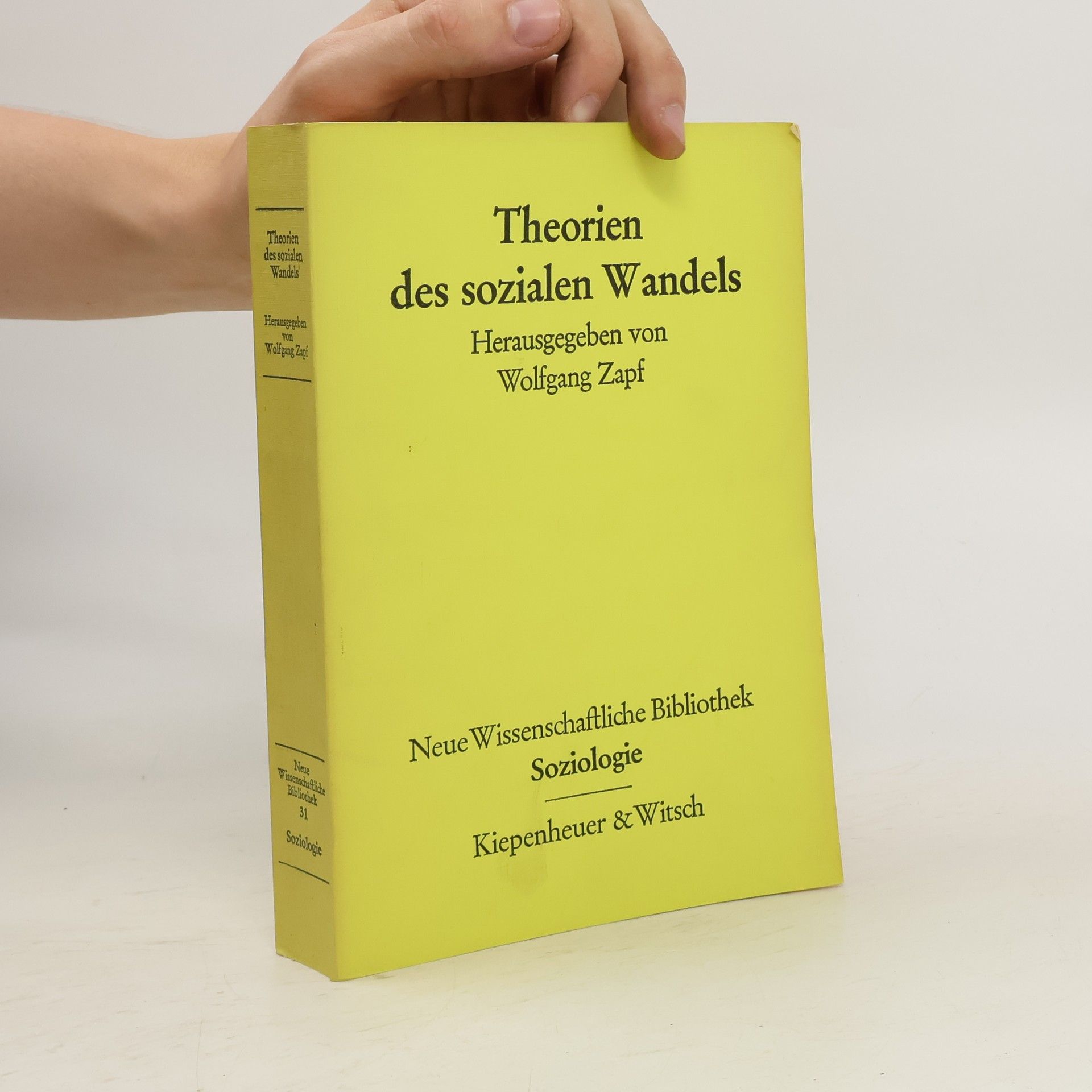
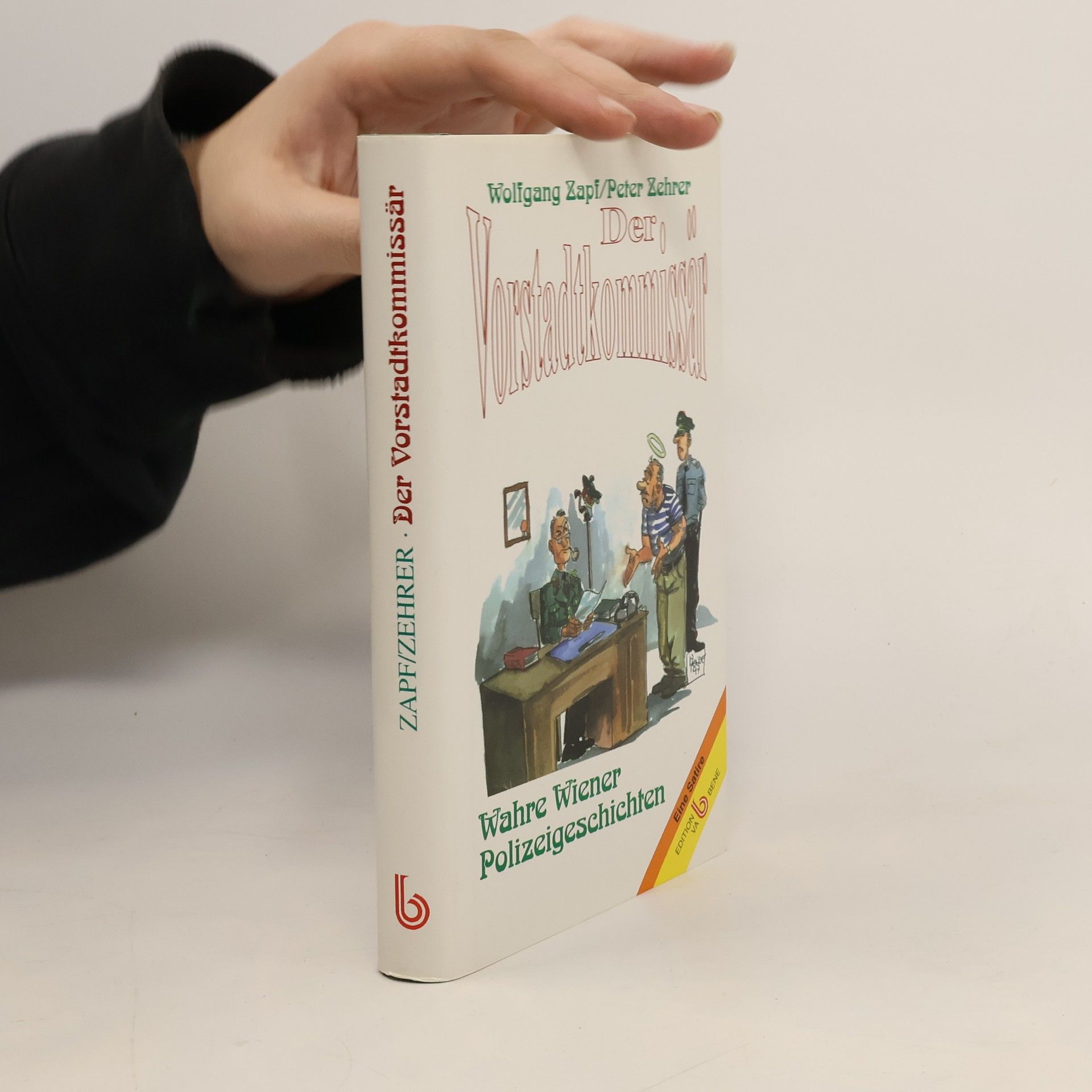
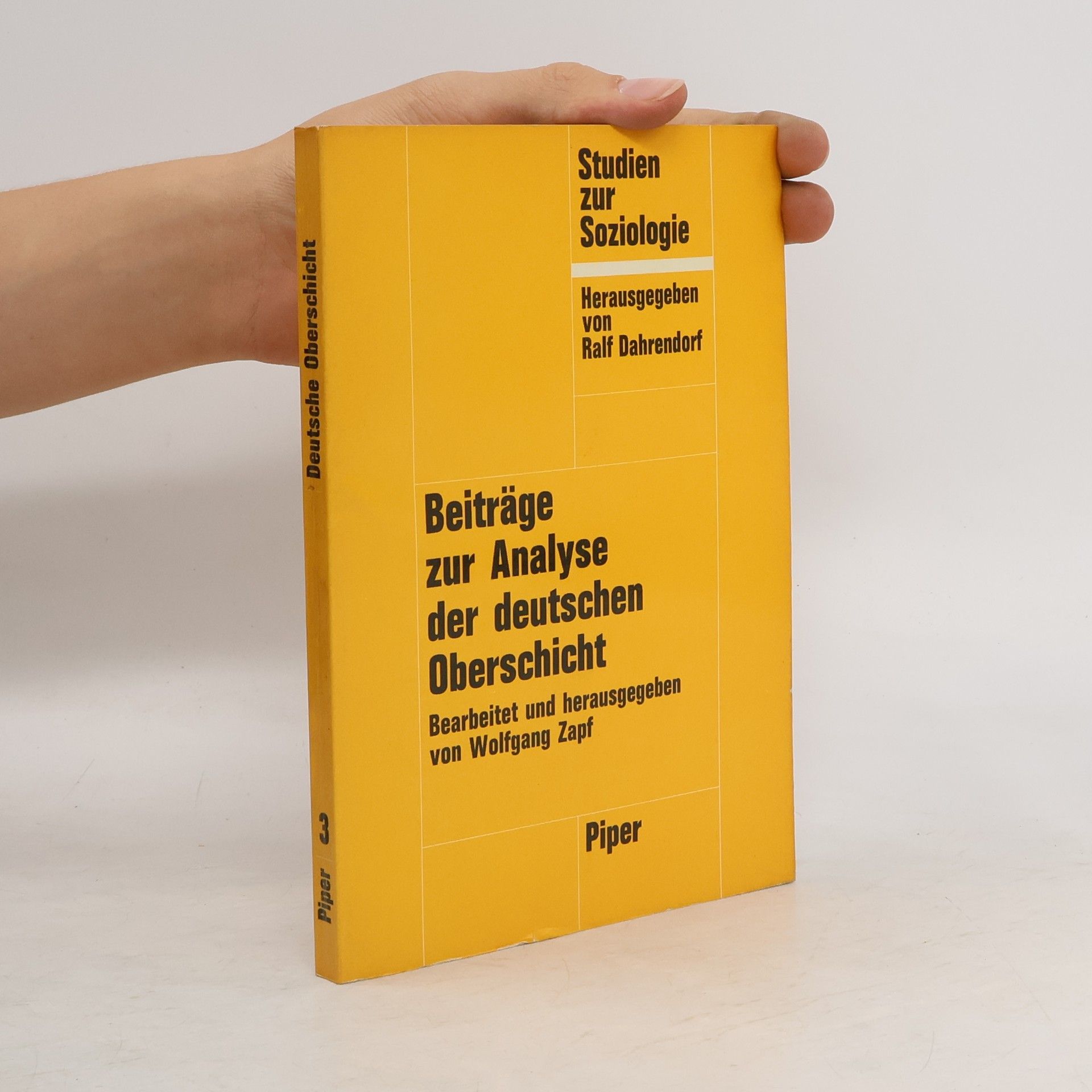
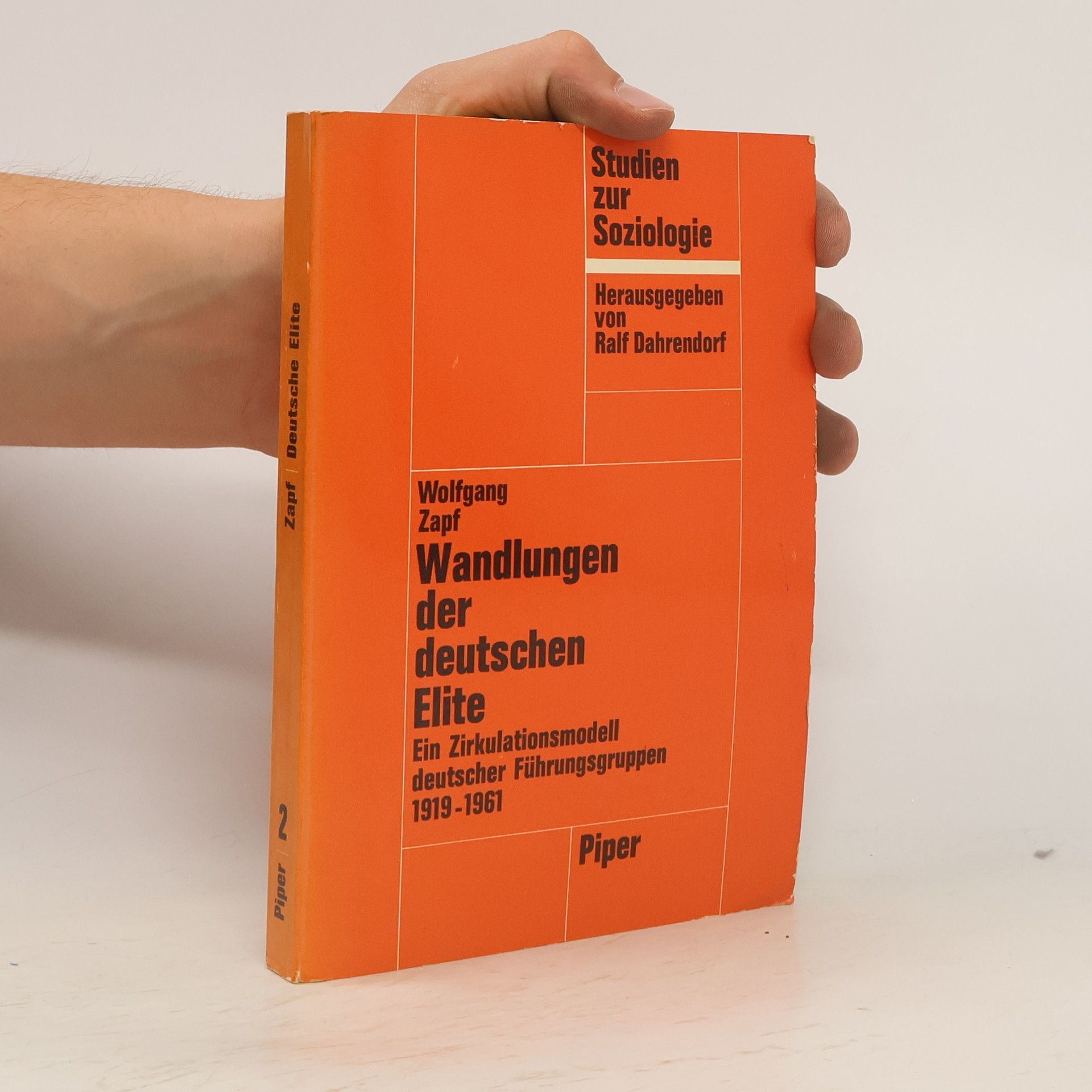
Jahrbuch 1994: Institutionenverglech und Institutionendynamik
- 379 pages
- 14 hours of reading
Wie reagieren Institutionen auf gesellschaftliche Entwicklungsprozesse und wie beeinflussen sie diese? Das 1994 erstmalig herausgegebene WZB-Jahrbuch versammelt Beiträge der WZB-Forschungseinheiten zum Thema „Institutionenvergleich und Institutionendynamik“ aus unterschiedlichen disziplinären und methodologischen Perspektiven. Mit einem vergleichenden Ansatz in räumlicher, zeitlicher und funktionaler Hinsicht wird untersucht, welche Erkenntnisse ein Institutionenvergleich und die Analyse der Dynamik von Institutionen bieten. Das Kapitel „Genese von Institutionen“ behandelt die Bildung von Parteiensystemen in Osteuropa. Im Abschnitt „Institutionen und ihre Interaktionen“ stehen die Beziehungen zwischen Wissenschaft, Praxis und Öffentlichkeit im Fokus. Der Themenbereich „Technische Entwicklung als Beispiel für institutionelle Dynamik“ beleuchtet die institutionelle Einbindung von Technikgenese und -kontrolle. Der Abschnitt „Felder institutioneller Dynamik“ thematisiert unter anderem Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik. Im Kapitel „Märkte als Institutionen und ihre Dynamik“ werden Innovationsprozesse sowie arbeits- und industriepolitische Herausforderungen der deutschen Industrie analysiert. Schließlich widmet sich das Themenfeld „Folgen des Institutionswandels“ der Wohlfahrtsentwicklung im vereinten Deutschland und dem Umbruch der Wissenschaft in Mittel- und Osteuropa.
Wirtschaftswissenschaft: Herausforderungen an den Wohlfahrtsstaat im strukturellen Wandel
- 525 pages
- 19 hours of reading
Gesellschaft, Demokratie und Lebenschancen
Festschrift für Ralf Dahrendorf
- 413 pages
- 15 hours of reading
Transformace a modernizační výzvy: sympozium evropských sociologů v Praze 2001
- 239 pages
- 9 hours of reading