Grammatik der deutschen Sprache
- 702 pages
- 25 hours of reading
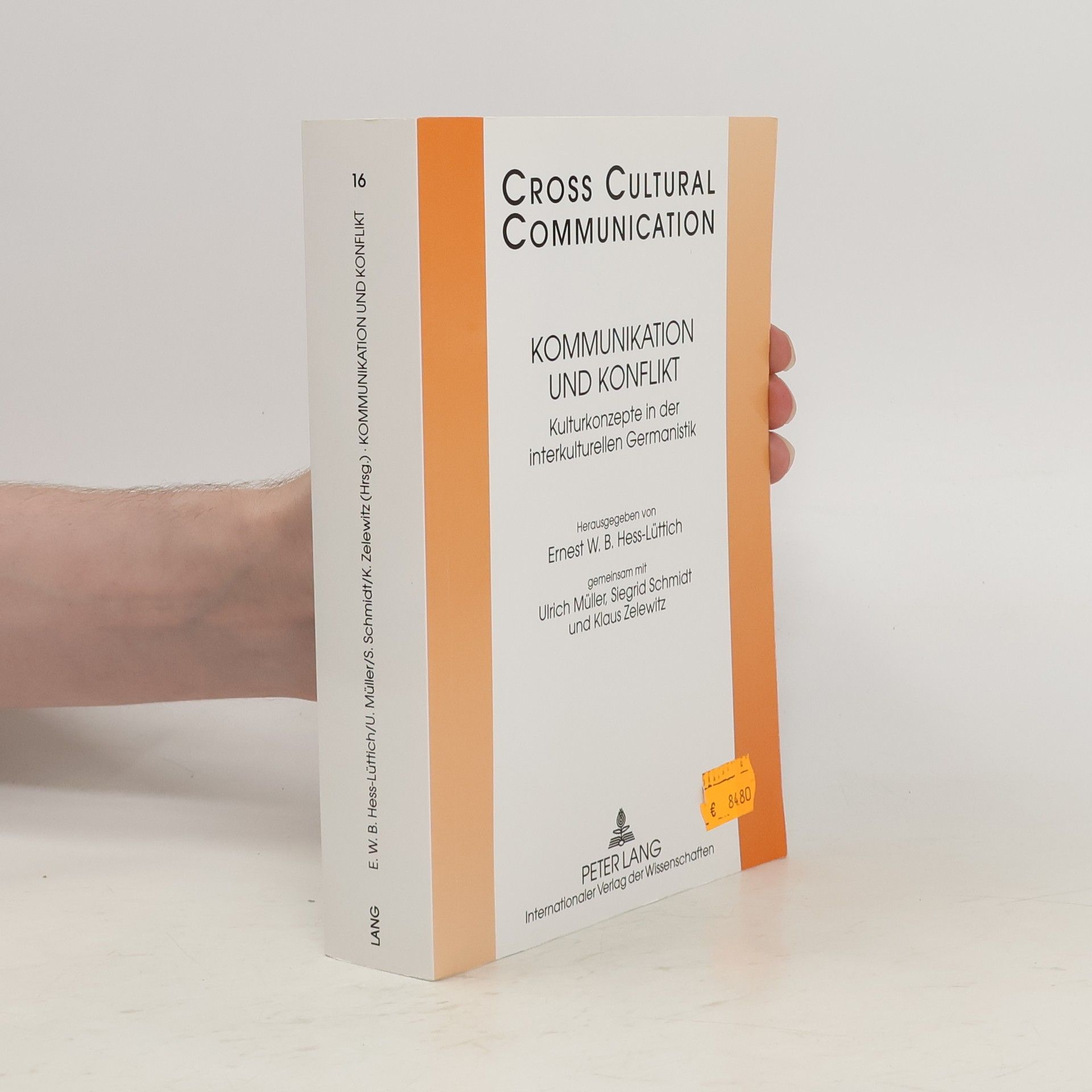
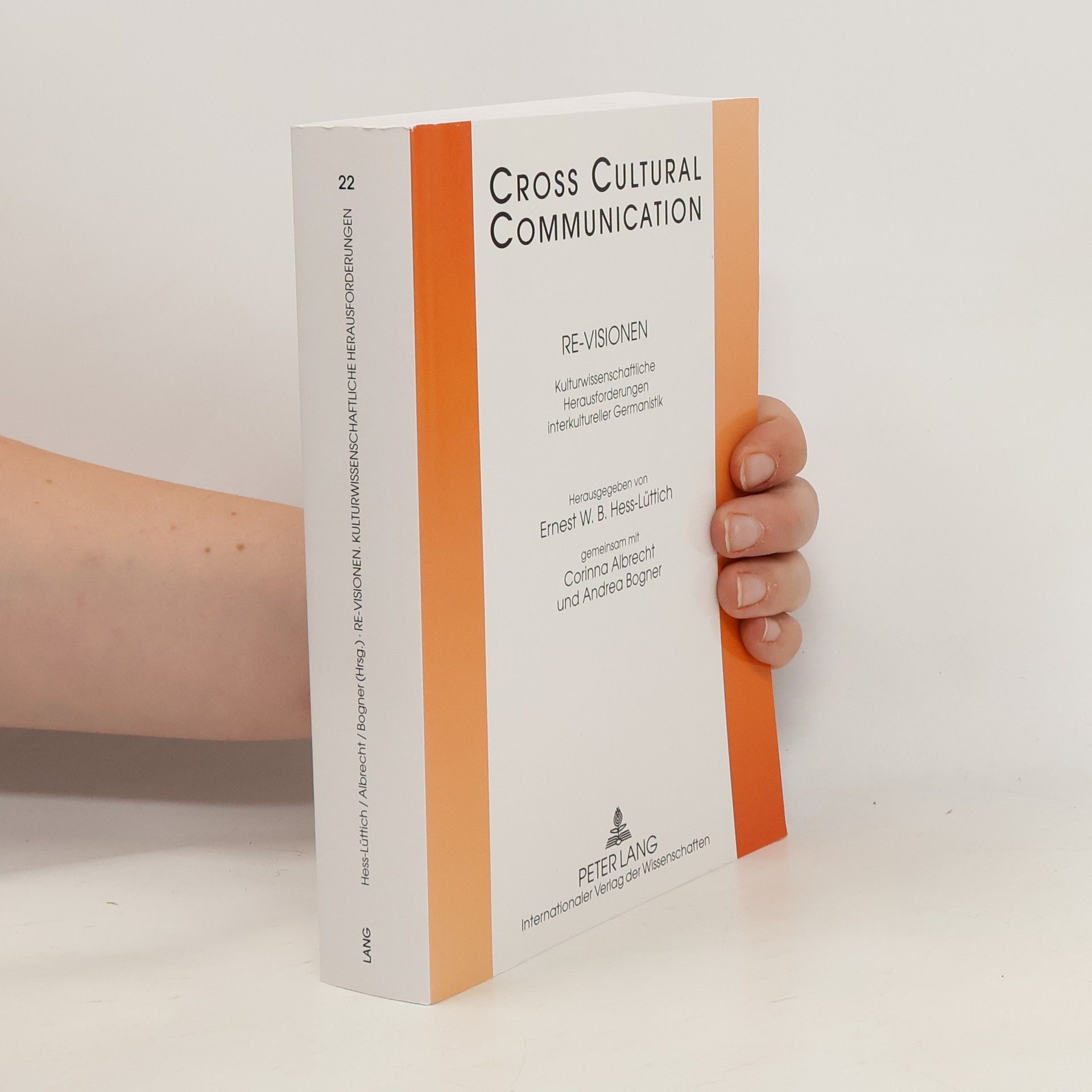

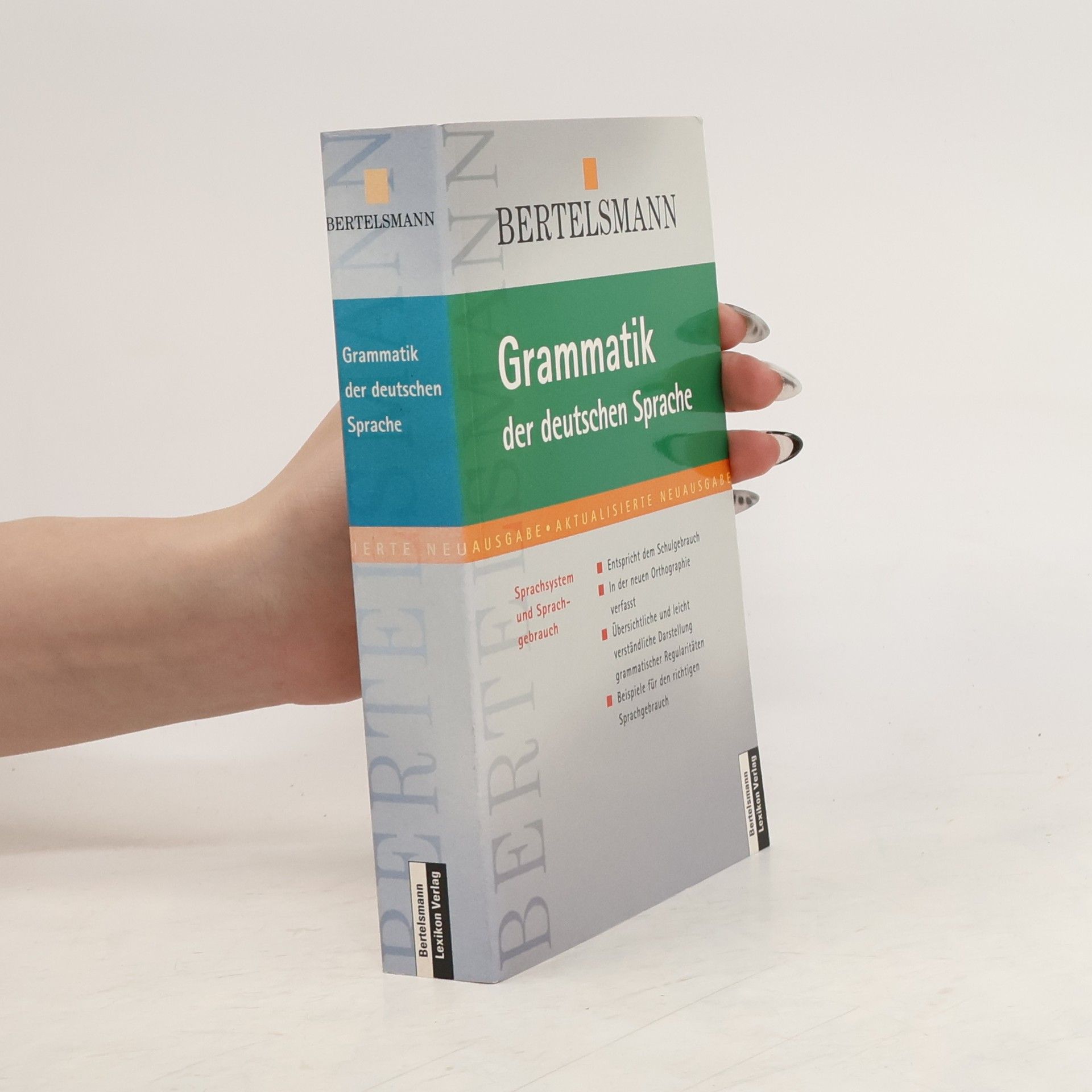
Zeichen der Stadt lesen: Am Beispiel von Berliner Quartieren, die im Fokus kontroverser Debatten stehen, diskutiert der Band Ansätze semiotischer, urbanologischer, ökologischer, linguistischer Provenienz als multidisziplinären Zugang zur Lektüre` urbaner Räume als Texte`. Der Band möchte dafür sensibilisieren, die 'Zeichen der Stadt' wahrzunehmen, sie zu 'lesen'. Am Beispiel ausgewählter Quartiere in Berlin, die in jüngster Zeit im Fokus kontroverser Debatten standen, möchte er Antworten suchen auf die Frage: Was sind urbane Diskurse? Diese Frage nach dem 'Wie' urbaner Kommunikation zielt auf deren (sozio)kulturelle Verfasstheit im Schnittfeld von Diskursforschung und Semiotik, Stadtökologie und Stadtsoziologie. Welche Ansätze können in einem interdisziplinären Forschungsdesign zur Anwendung kommen, um die Diskursbedingungen urbanen Wandels zu verbessern? Die einleitend vorgestellten Ansätze semiotischer, urbanologischer, ökologischer, linguistischer Provenienz sollen einen multidisziplinären Zugang für die 'Lektüre' urbaner Räume als 'Texte' bieten. Inhaltsverzeichnis Urbanität Diskursforschung Stadtplanung, -ökologie, -soziologie Raumwissenschaft Ökosemiotik Stadtsprachen Sprachlandschaften
Kulturwissenschaftliche Herausforderungen interkultureller Germanistik
Die anhaltende Auseinandersetzung mit Konzepten der Kultur, der Interkulturalität, des Fremdverstehens hat parallel zur Entwicklung in anderen Disziplinen auch in der international orientierten Germanistik zu ihrer kulturwissenschaftlichen Fundierung, zur Reflexion unterschiedlicher Theoriestränge und zur Überprüfung einer ausschließlich in der europäischen Tradition entwickelten Begrifflichkeit geführt. Die Konsequenz ist eine gewisse Mobilität von theoretischen Konzepten, wie sie der Kontingenz ihrer Gegenstände entspricht. Das betrifft den Kern des aspektheterogenen Terminus Kultur ebenso wie davon abgeleitete Konzepte von Interkulturalität, Transkulturalität oder Multikulturalität. Vor diesem Hintergrund stellt sich der Band Re-Visionen die Aufgabe, zentrale Ausgangsfragen interkultureller Germanistik in Beziehung zu setzen zu kulturwissenschaftlichen Entwicklungen der letzten beiden Dekaden. Gibt es neue Antworten auf alte Fragen? Sind manche Fragen heute anders zu stellen? Tauchen neue Fragen auf, die neue Konzepte und Verfahren verlangen? Solchen Aufgabenstellungen widmen sich die hier versammelten Beiträge im Blick auf das Verhältnis von Text und Kontext, von Literatur(sprache) und Interkulturalität, von Kultur(vermittlung) und Übersetzung, von Interkulturalität und Mehrsprachigkeit.
Kulturkonzepte der interkulturellen Germanistik- Redaktion: Tobias Keller und Urs Wartenweiler
Interkulturelles Denken basiert auf Kulturkonzepten der jeweils daran Beteiligten. Im Verhältnis, welches die Räume und individuellen Ausprägungen der einzelnen Kulturen zueinander herausbilden, formen sich verschiedene Kombinationen von Kommunikation und Konflikt: Dabei stehen auf der einen Seite die Möglichkeiten, ja Notwendigkeiten von Kommunikation und Dialog, auf der anderen Seite die Realität von oft starken Konflikten bzw. Konfliktpotentialen, durch unterschiedliche Ausgangspositionen verursacht oder ausgelöst und daher divergierenden Interessen. In der Sprache und in der mit den Mitteln der Sprache gestalteten Literatur (im weitesten Sinn) findet dieser Befund auf die unterschiedlichste Weise seinen Niederschlag. Dies betrifft auch und erst recht den wissenschaftlichen Umgang damit, also jede interkulturell motivierte Interpretation.