Berühmte Frauen
Kalender 2002


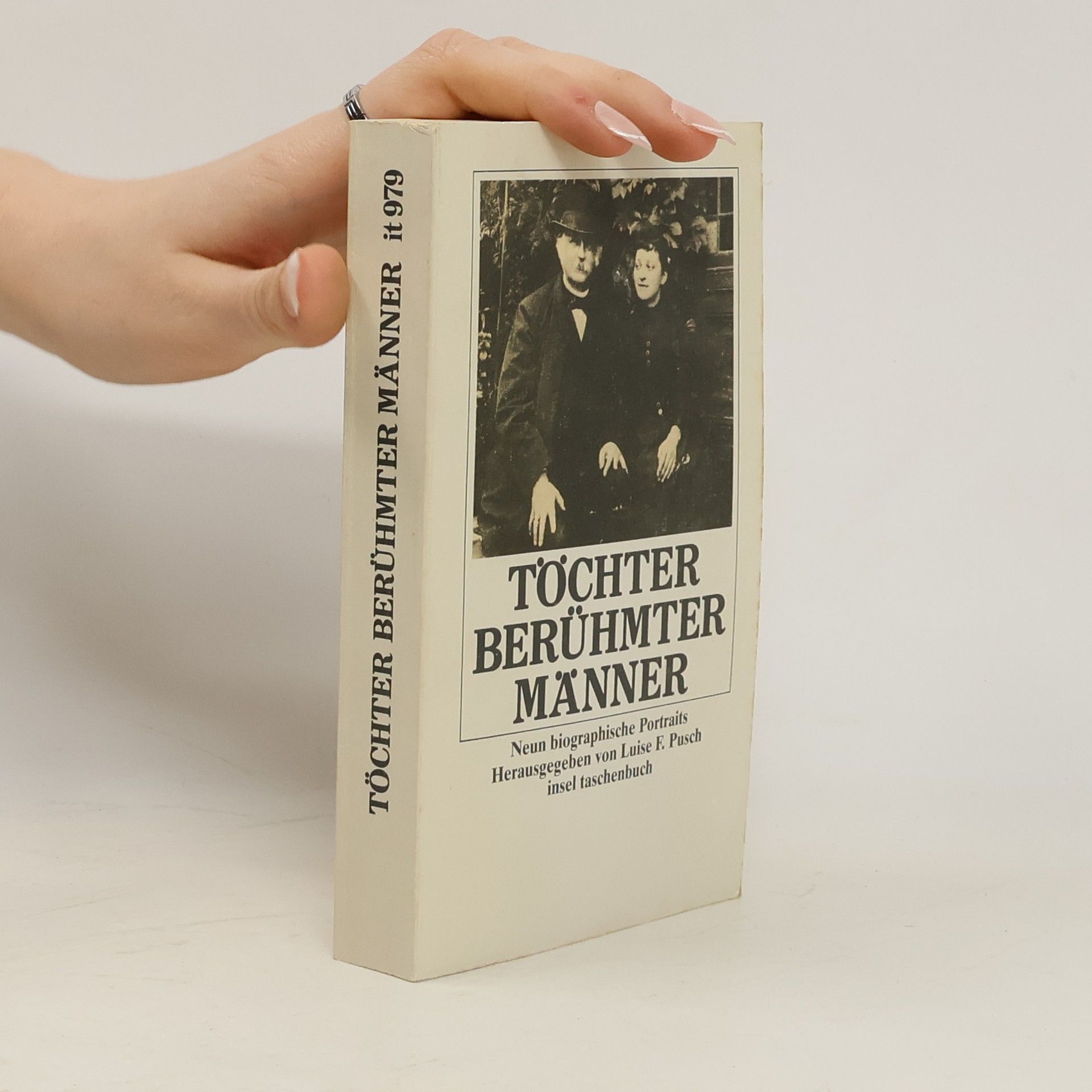
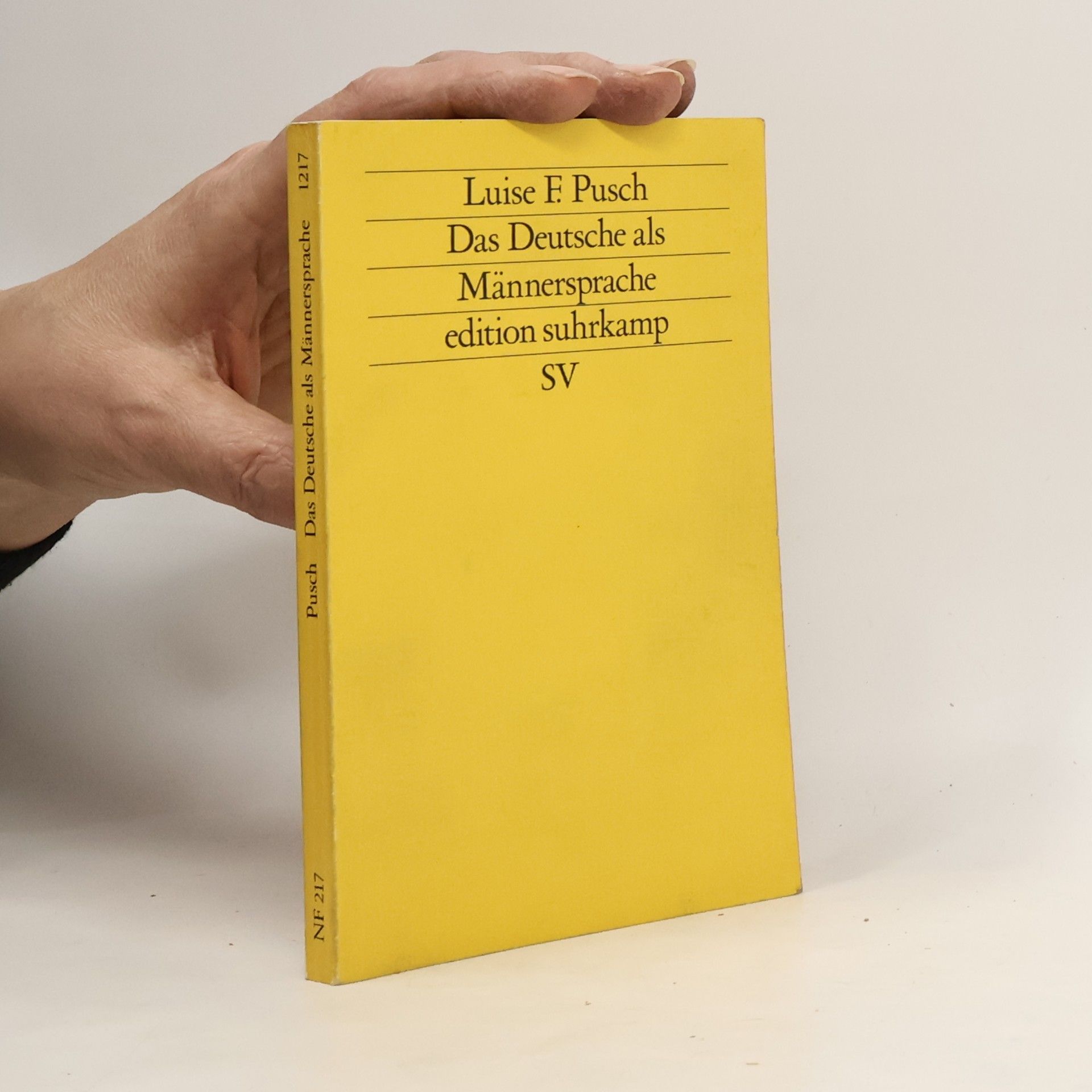

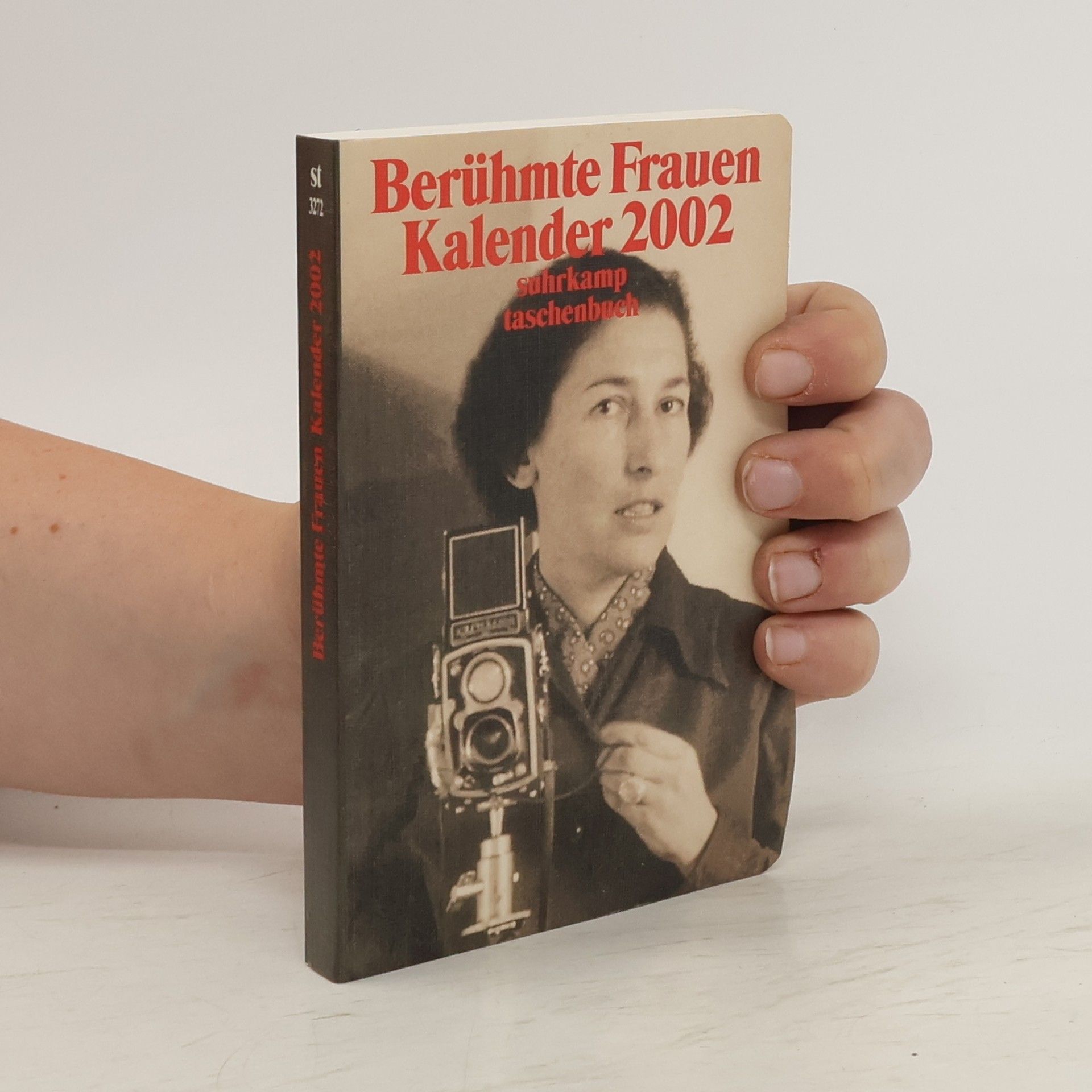
Kalender 2002
The book features a diverse collection of writings by notable authors, exploring themes of identity, gender, and cultural experiences. Ingeborg Bachmann pays tribute to Maria Callas, while Marieluise Fleißer presents a portrait of Buster Keaton. Hedwig Dohm addresses the dynamics of women in conflict, and Sylvia Plath reflects on familial relationships in "Papi." Helene Lange discusses the role of mentors in girls' education, and Adrienne Rich examines the invisibility of women in academia. Mascha Kaléko highlights women's contributions to culture, and Adelheid Popp shares personal reflections on education. Glückel von Hameln recounts experiences from her marriage and move to Hamburg. Erma Bombeck offers humorous takes on motherhood, while Margrit Baur contemplates life's decisions. Imgard Keun asserts her independence, and Carson McCullers reflects on the inevitability of death. Marlen Haushofer presents a unique perspective in "Die Ratte," and Charlotte Perkins Gilman critiques societal norms in "Die gelbe Tapete." The anthology also includes works by Emily Dickinson, Annette Droste-Hülshoff, and Virginia Woolf, among others, addressing themes of love, loss, and the female experience. Through these varied voices, the collection invites readers to engage with complex narratives and reflections on life.
Aufsätze und Glossen zur feministischen Linguistik
Die feministische Linguistik entlarvt die Geschichte und Struktur der Sprachen als Männergeschichte und Männerstruktur. Die feministische Linguistik fundiert und dokumentiert die sprachkritische, sprachschöpferische und sprachpolitische Arbeit der Frauen. Speziell zum Deutschen gibt es bislang nur die wissenschaftlichen und journalistischen Arbeiten der Konstanzer Linguistin Luise F. Pusch, die hier erstmals gesammelt vorgelegt werden.
Historisch ist die Vater-Tochter-Beziehung bisher kaum aufgearbeitet worden. Der vorliegende Band macht einen Anfang. Vorrangig geht es dabei allerdings um Frauen der Vergangenheit, seien sie nun bedeutend oder nicht, als Beispiel dafür, wie Frauen früher leben mußten. Der "berühmte Mann", diesmal in der Rolle des Vaters, ist nur Mittel zum Zweck.
In 13 Porträts werden Kate Chopin, Elisabeth von Österreich, Marieluise Fleißer und andere begabte Frauen untersucht, die aufgrund ihres Andersseins aus den gesellschaftlichen Normen fallen. Die Autorinnen analysieren die Ursachen ihrer seelischen Leiden und den hohen Preis, den sie für ihre Kreativität zahlen.
„Von Rabenmüttern, selbstbewußten und »richtigen« Müttern ist die Rede; von Müttern, an denen gleich zwei Patriarchen mit widersprüchlichen und konkurrierenden Ansprüchen zerrten. Von Katharina Keppler, Dorothea Händel, Anna Maria Mozart, Johanna Christiane Hölderlin, Jennie Churchill, Wen-Chi Mei (der Mutter Maos) und anderen.“
Hat der Kaiser Franz Beckenbauer seiner Heidi das Ja-Wort gegeben? Oder umgekehrt? Dürfen Frauen Männerlieder singen? Warum handelt es sich bei einer Beziehung zwischen einem Dichter im Rentenalter und einer Frau, die noch keine 20 ist, um einen »liebenden Mann«, während eine Beziehung zwischen einer reifen Frau und einem jungen Mann als skandalös angesehen wird?Von Hillary Clintons Rennen um die demokratische Kandidatur für die amerikanische Präsidentinschaft zu Heldinnen und Helden der Kinder- und Jugendliteratur wie Pippi Langstrumpf und Harry Potter; von Lessings Neffen Gysi zu den Eisbärkindern Flocke und Knut: In rund 50 neuen Glossen richtet Luise F. Pusch die schiefe Ebene zwischen den Geschlechtern mit sprachlichem Witz.
Das Maskulinum ist nicht mehr das was es einmal war. Aber Herrenkultur und Herrensprache sind keineswegs überwunden. Deshalbt nervt frau zügig weiter.
Der Schwestern-Sammelband soll mithelfen, uns das verschüttete, verzerrte, entfremdete weibliche Erbe wieder präsent und verfügbar zu machen. Der Weg über den bereits übermäßig präsenten Bruder ist dabei nur Mittel zum Zweck, das die Spurensicherung erleichtert.