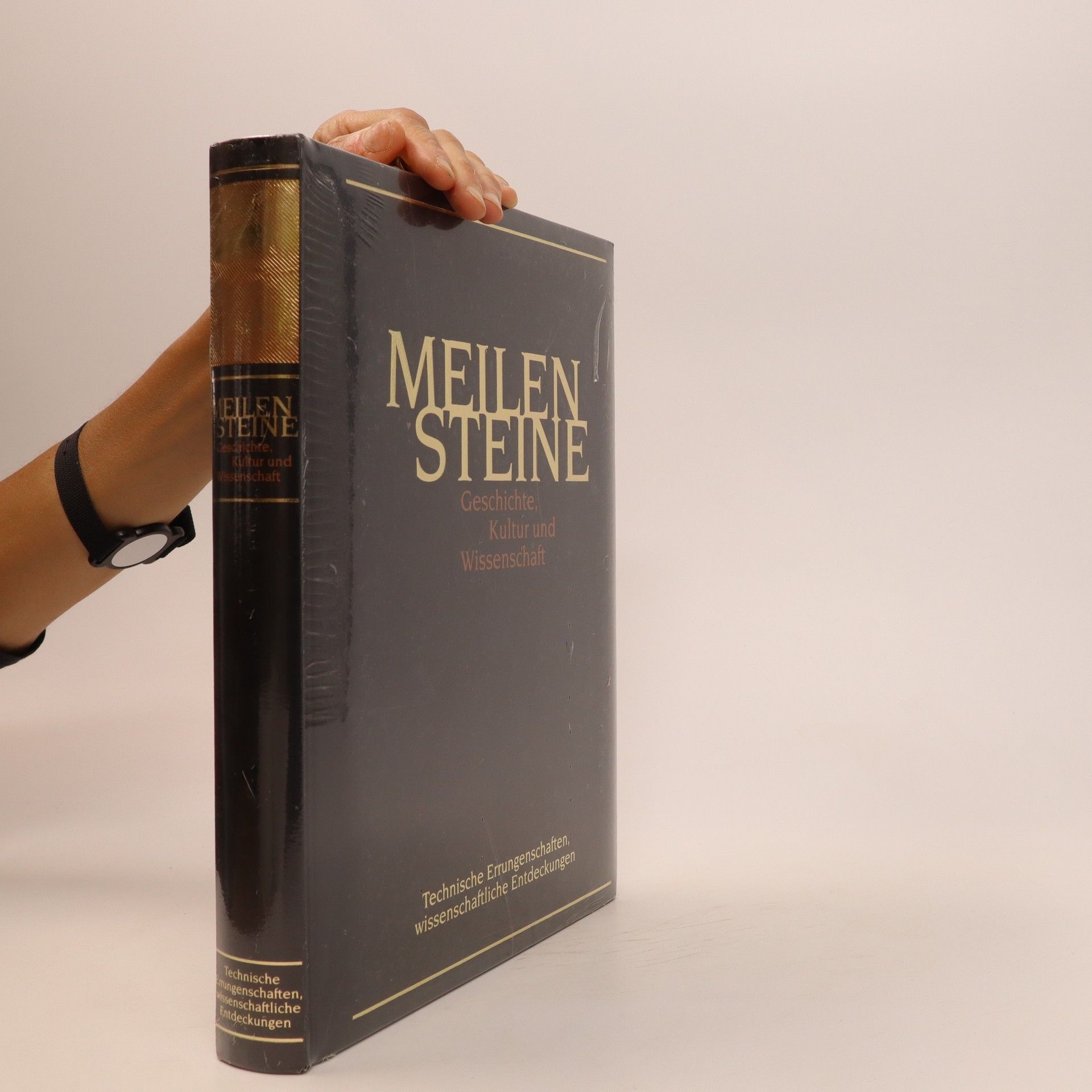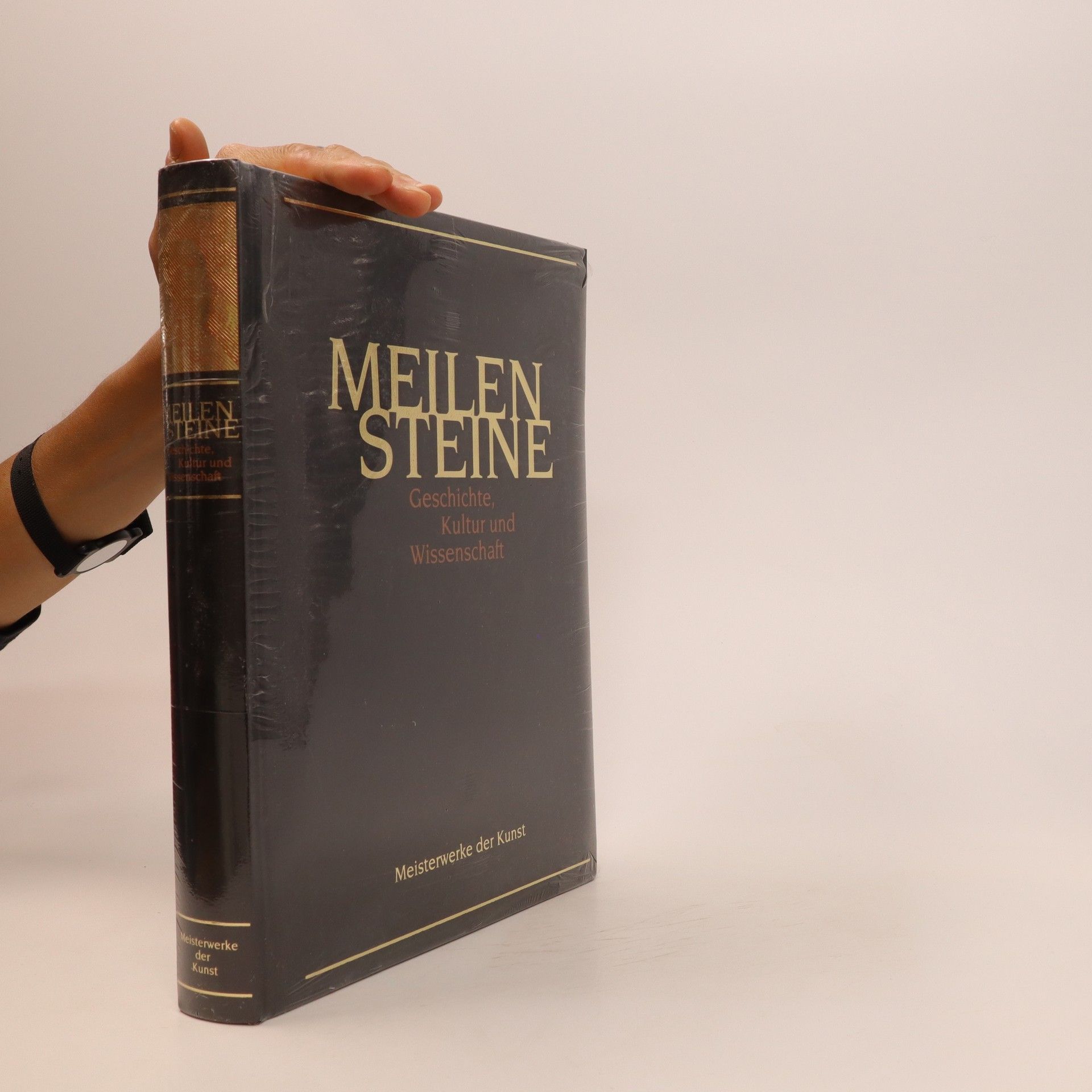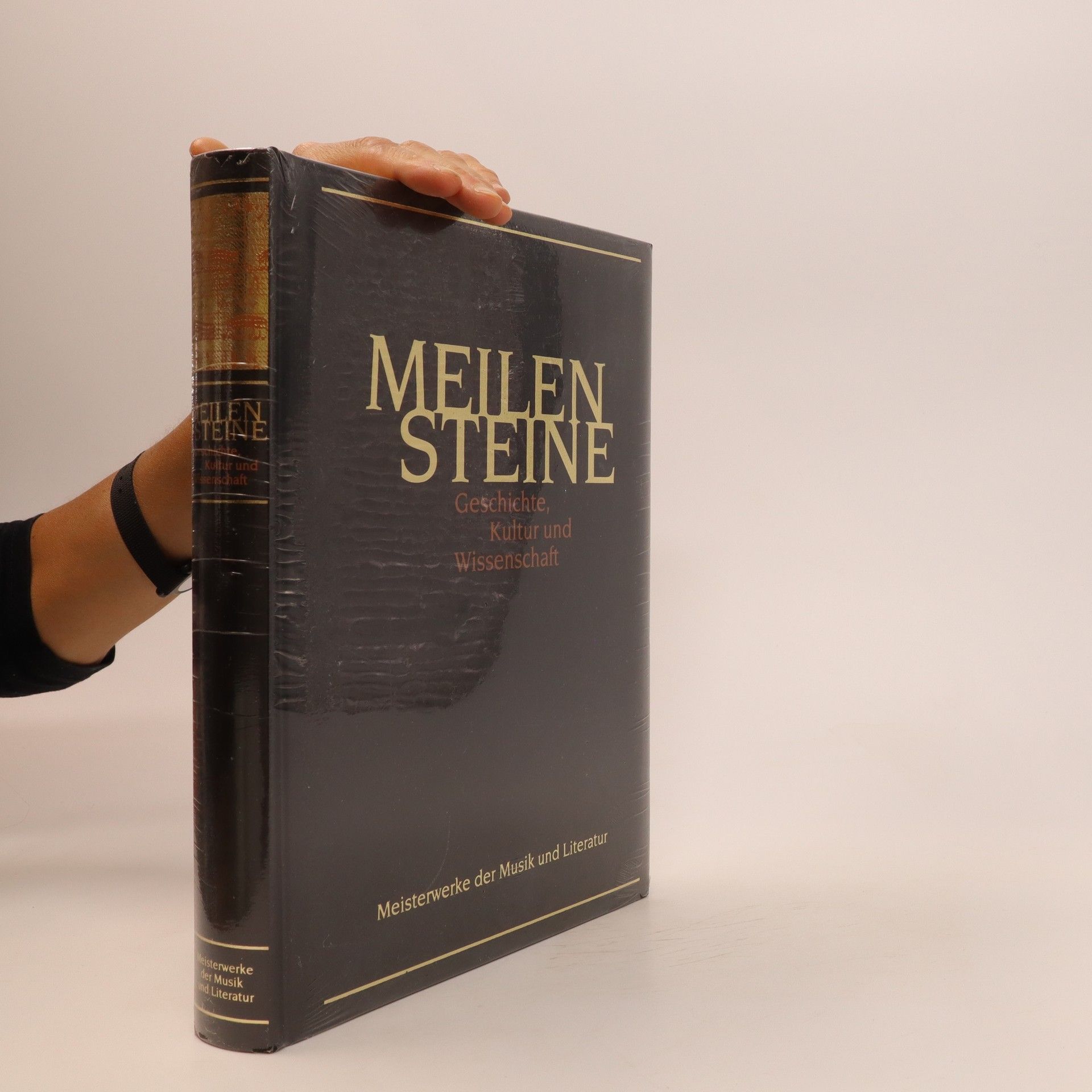Strafbarkeit politischer Fake News.
Zugleich eine Untersuchung zum materiell-rechtlichen Umgang mit der Informationswahrheit in Zeiten demokratiegefährdender Postfaktizität.
- 343 pages
- 13 hours of reading
Die Untersuchung beleuchtet die Auswirkungen politischer Fake News auf den öffentlichen Diskurs und die Abkehr der Bürger von rationalen Fakten hin zu emotionalen Meinungsbildungen. Sie analysiert, welche rechtlichen Mittel zur Verfügung stehen, um die Informationswahrheit zu fördern und den Schutz der Demokratie zu gewährleisten. Dabei wird ein rechtsgebietsübergreifender Ansatz verfolgt, um die Rolle des materiellen Rechts im Kampf gegen politische Desinformation zu klären.