Die Untersuchung des Naturerlebens eröffnet einen Dialog zwischen der Wahrnehmung der Natur und der poetischen Darstellung durch Dichter und Dichterinnen. Dabei wird die Resonanz zwischen der natürlichen Welt und den künstlerischen Ausdrucksformen in Rhythmus, Klang und bildlicher Sprache beleuchtet. Die Autorin vertieft sich in die alte chinesische Kultur und erforscht den Unterschied zwischen Körper und Leib, was zu einem tieferen Verständnis der Naturerfahrung führt. Dieses Werk ist das fünfte Buch der Autorin und verbindet ästhetischen Genuss mit kulturellem Erbe.
Gudula Linck Books
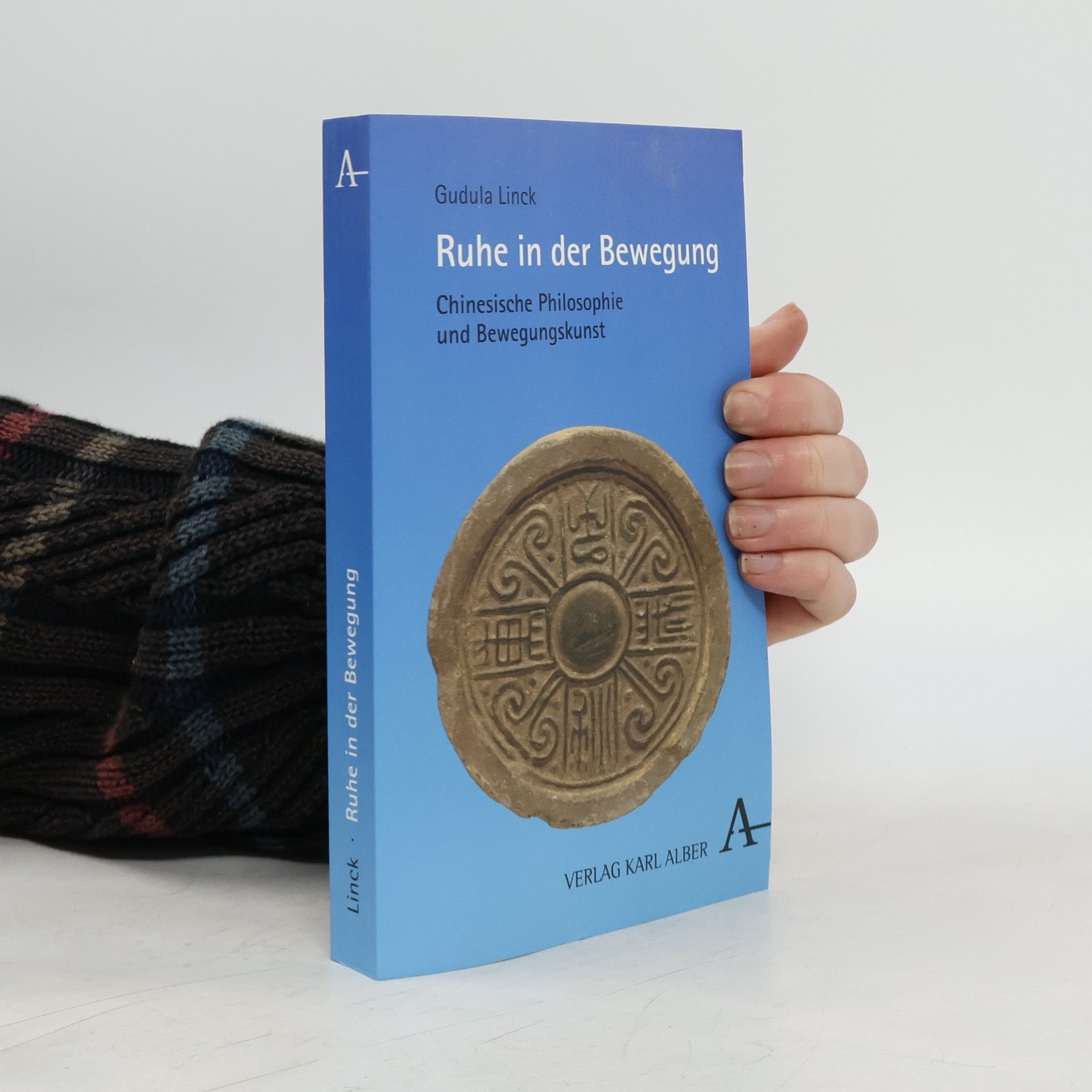
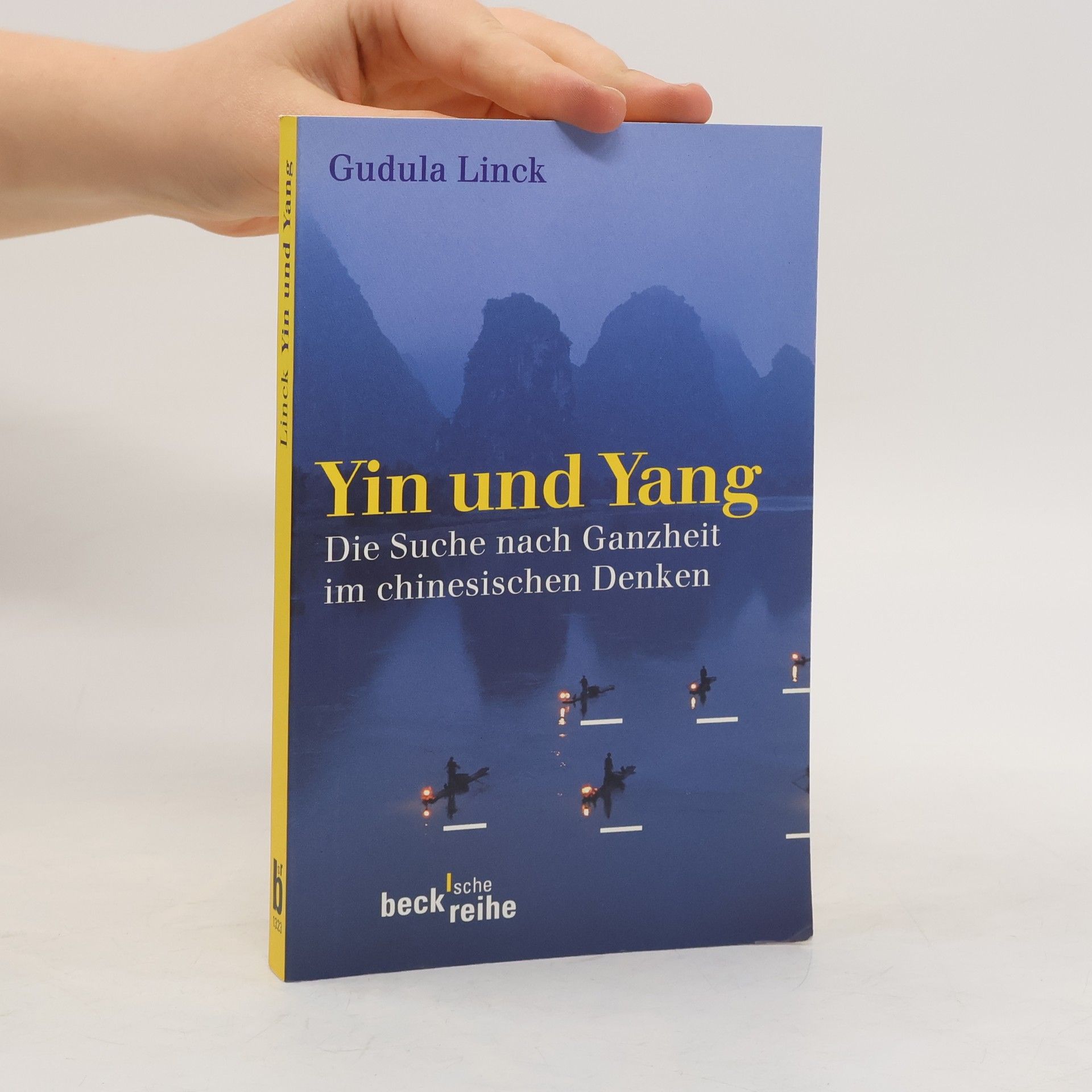

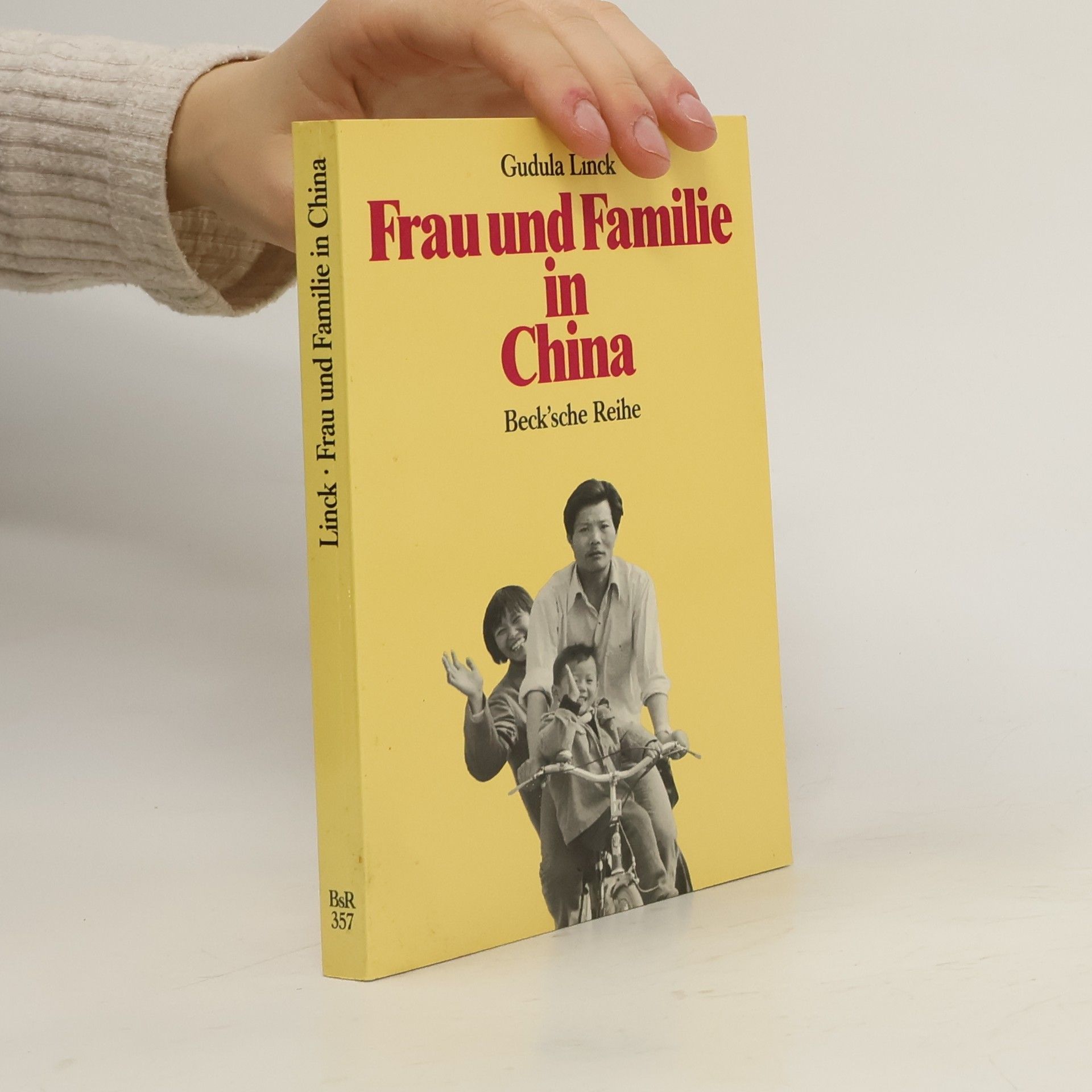

Yin und Yang
- 161 pages
- 6 hours of reading
Ruhe zu finden in der Bewegung ist ein Ausdruck von Gegenwart, der der Sprunghaftigkeit und jedem Kalkül widerspricht. Dies spiegelt den Zauber ostasiatischer Philosophie und Bewegungskunst wider. Der Widerspruch von Ineinander und Miteinander sowie die Verwandlung ins Gegenteil werden in altchinesischen Texten durch paradoxe Denkfiguren wie „Ruhe in der Bewegung“ und „Dauer, die keine Zeit hat“ verdeutlicht. Auch praktische Erfahrungen in chinesischer Bewegungskunst ermöglichen es, diese Konzepte am eigenen Leib zu erfahren. Der erste Teil des Buches untersucht die philosophischen Denkbegriffe und deren Verbindung zur Leib- und Lebenserfahrung, um im zweiten Teil diese Erfahrungen durch verschiedene Bewegungskünste zu vertiefen. Neben Atem- und Bewegungsübungen wird untersucht, wie die Bewegungserfahrung das Individuum beeinflusst. Zu den Bewegungskünsten zählen Qígong, das Spiel der Tiere, Kampfkunst und die langsame Variante Tàijíquán sowie Dichtung, Malerei, Kalligraphie, Musik und Fengshui. Der dritte Teil widmet sich der Meditation im handwerklichen Tun und stillen Sein, in dem auf einzigartige Weise „Ruhe in der Bewegung“ und „Bewegung in der Ruhe“ erlebt werden kann.