Dieter Naumann Books

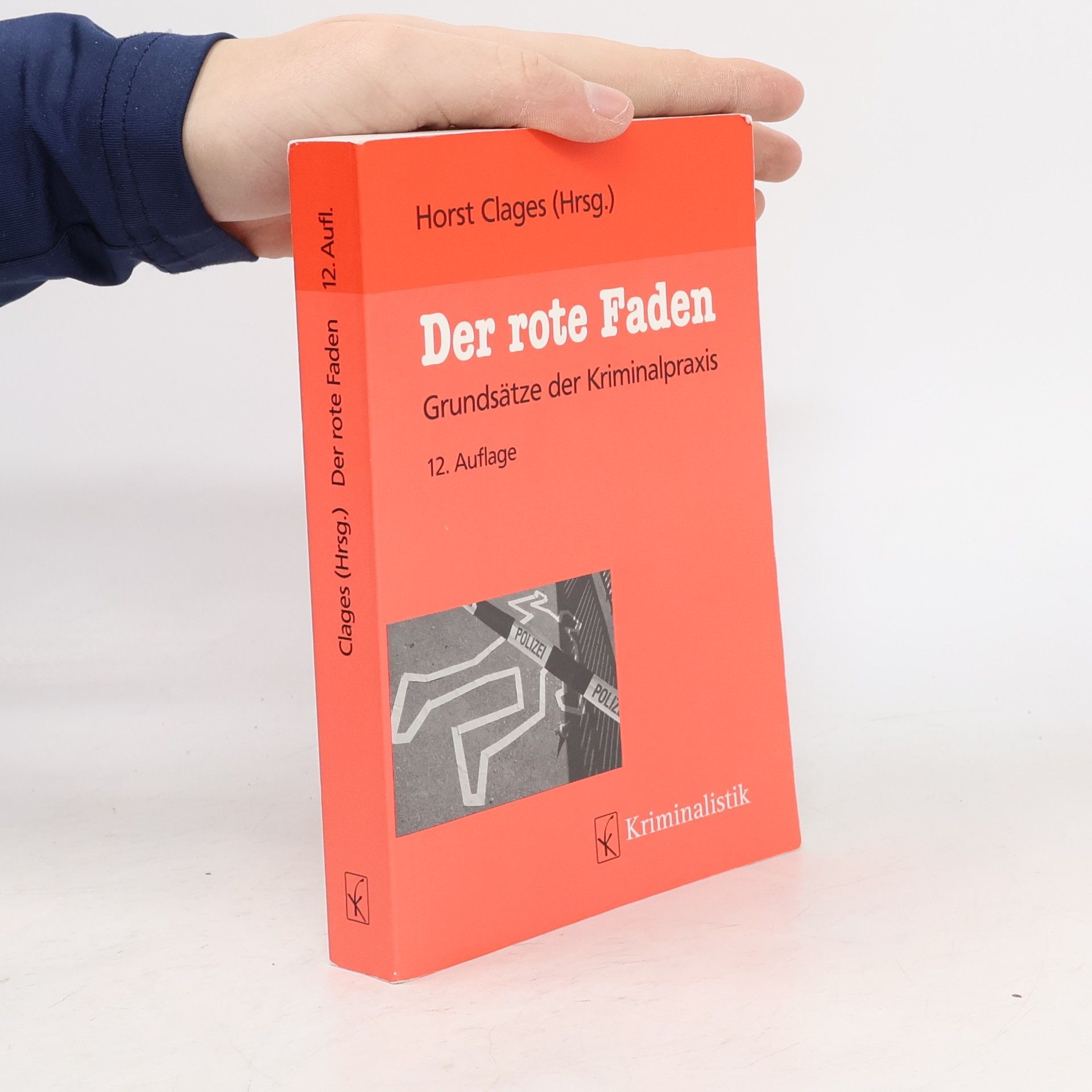



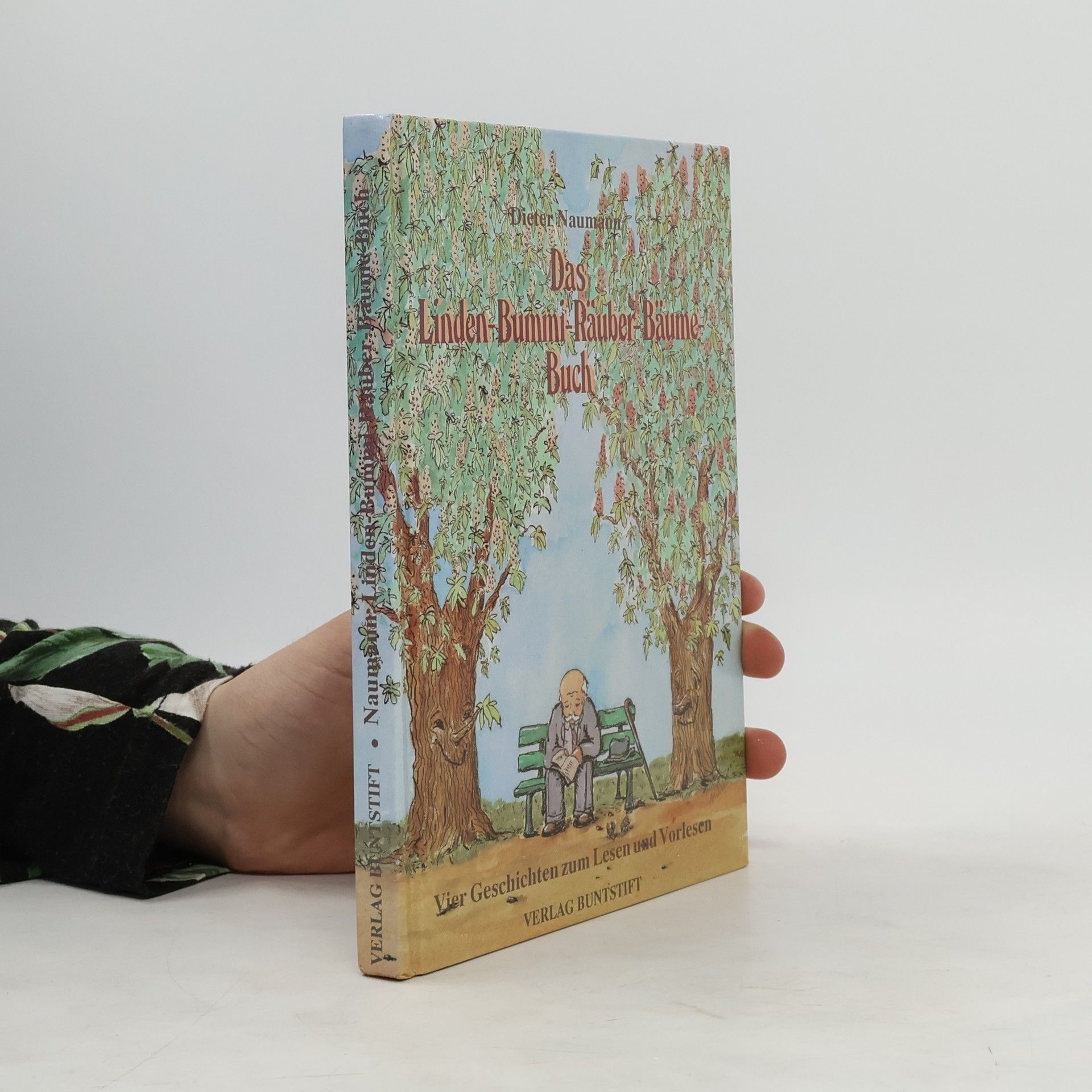
„Rügen – der Kalender“ 2025 bietet historische und humorvolle Ansichtskarten, die den Badetourismus auf Rügen seit dem 19. Jahrhundert zeigen. Neben bildlichen Darstellungen gibt es kurze Erläuterungen zu den Karten, und Verweise auf die Reihe „Rügener Sammelsurium“ ermöglichen vertiefende Lektüre und weitere Illustrationen.
Mönchgut
zwischen 1850 und 1950
Nach dem tollen Erfolg des ersten Teiles des Rügener Sammelsuriums legt der Autor nun den zweiten Teil vor. Dabei behält er das Prinzip des ersten Teils bei: Geschichte und Geschichten unterschiedlicher Thematik von Deutschlands größter Insel werden erneut in lockerer Form aneinander gereiht und mit Fotografien, historischen Ansichtskarten und anderen Dokumenten illustriert. Die Palette der Themen umfasst die Beschreibung von Persönlichkeiten, teils tragische, teils amüsante Ereignisse, Erläuterungen von Begriffen in Reiseführern, deren Bedeutung sich im Laufe der Zeit verändert hat, einst übliche Verhaltensregeln bei Reisen in die Bäder, allerlei über Rügens Straßen, die Eskapaden eines Storches und anderes mehr. Dieter Naumann gelingt es erneut, seine subjektiv ausgewählten Themen unakademisch darzustellen und - wo es sinnvoll erscheint - verständlich zu erklären. Insgesamt wieder ein empfehlenswertes Buch für Rügenbesucher, die ihren Urlaub nachbereiten oder vorbereiten wollen, aber auch für Rüganer, die sich an Bekanntes aus Rügens Geschichte erinnern oder vielleicht auch Neues über ihre Insel erfahren möchten.
Dieses Handbuch für die Kriminalpraxis behandelt u.a. folgende Themen: - Einführung in die Kriminalistik - Das strafprozessuale Ermittlungsverfahren - Kriminaltaktik - Kriminaltechnik - Forensische Wissenschaften - Spezielle Kriminalistik - Internetkriminalität
Ein Besuch bei Beethoven
Ein Buch für Kinder, Eltern, Lehrer und andere Beethoven-Freunde
- 71 pages
- 3 hours of reading