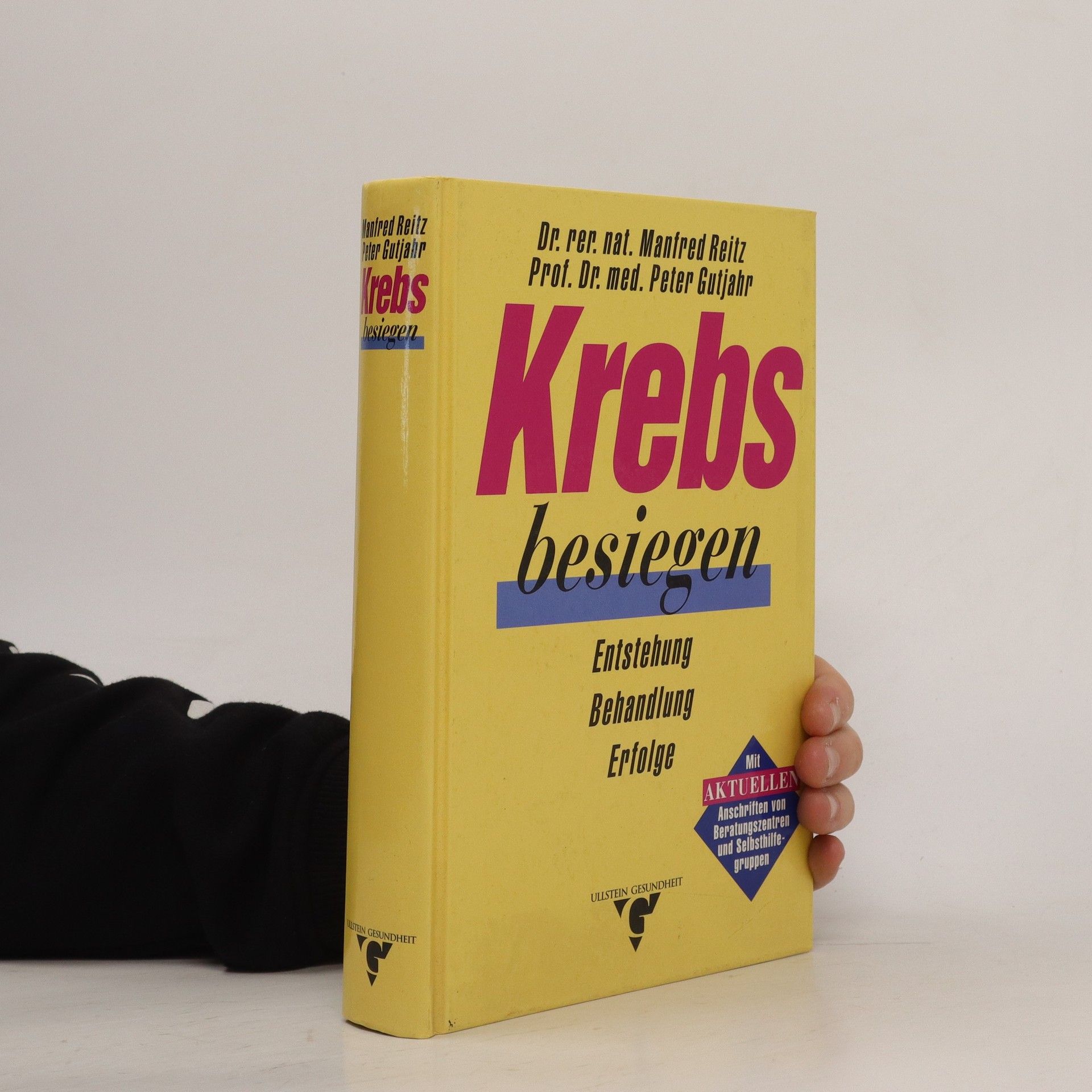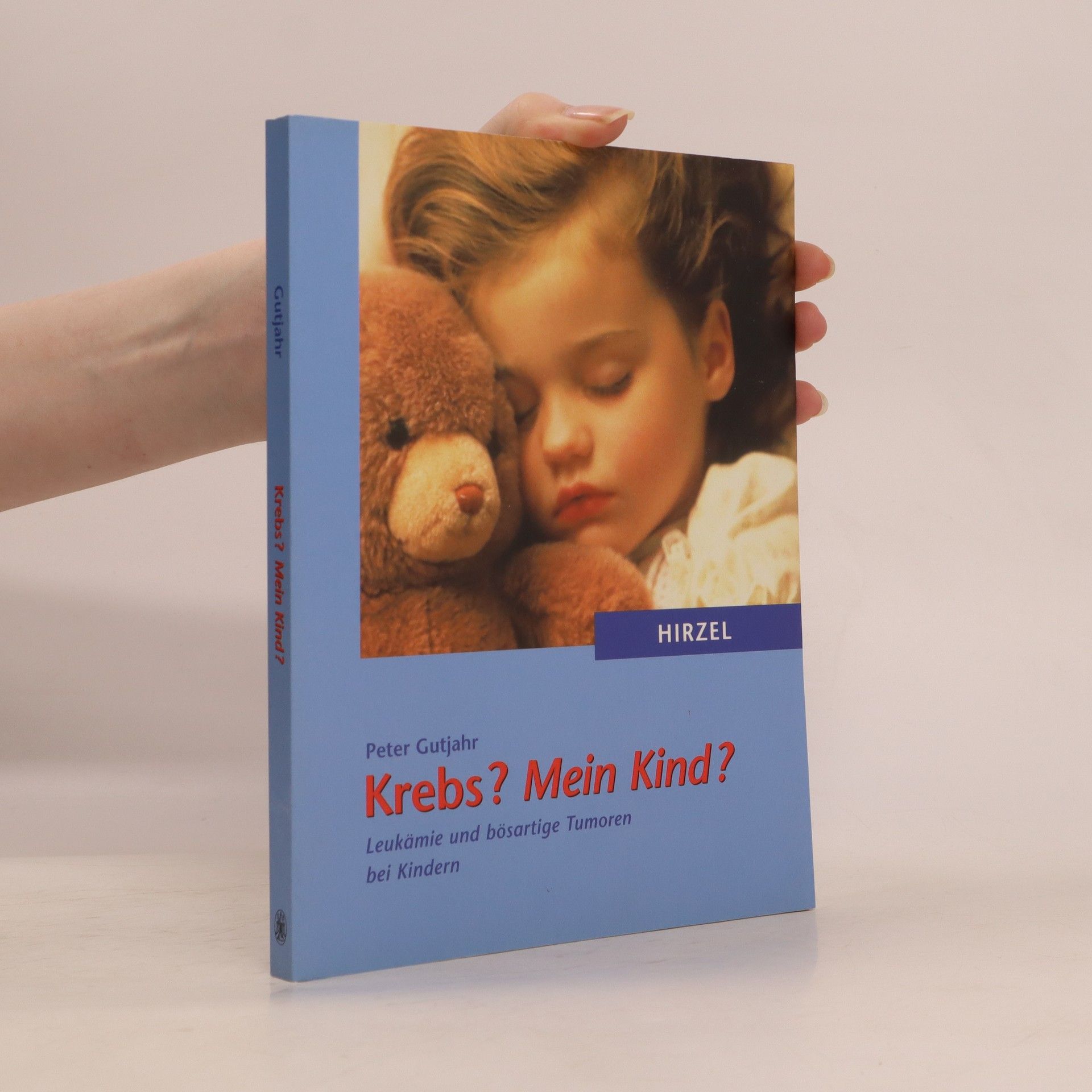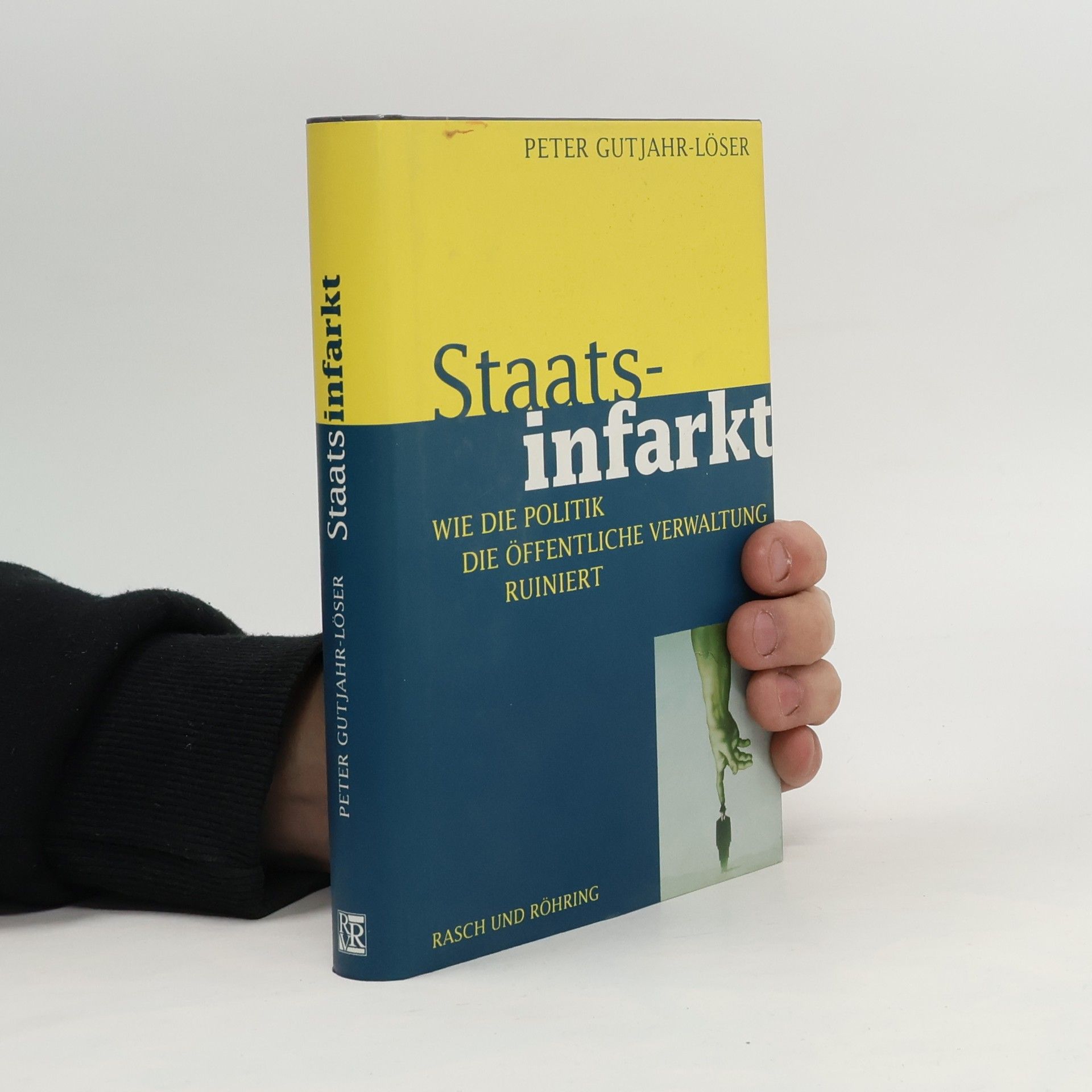Hinter den Kulissen
Die Erneuerung der Universität Leipzig nach der Friedlichen Revolution
In der über sechshundertjährigen Geschichte der Universität Leipzig gab es neben ruhigen Phasen auch Zeiten tiefgreifender Umwälzungen. Besonders prägend war die Zeit Anfang der neunziger Jahre, als die deutsche Einheit 1990 eine sofortige Integration der Universität in die bundesdeutschen administrativen und wissenschaftlichen Rahmenbedingungen erforderte. Dies brachte gravierende institutionelle Veränderungen und eine umfassende personelle Neuausrichtung mit sich. Zudem galt es, ein neues Wissenschaftsverständnis zu etablieren, das auf den Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung basiert. In diesem Kontext spielte der Kanzler der Universität, eine Funktion, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht existierte, eine Schlüsselrolle. Der Autor reflektiert in diesem Werk seine Erfahrungen aus eineinhalb Jahrzehnten im Amt, umfassend und detailreich. Diese Veröffentlichung ergänzt die bisherigen Werke zur Geschichte der Universität Leipzig, die oft auf die sogenannte Königsebene fokussiert sind, und bietet eine anschauliche, faszinierende und humorvolle Darstellung der dramatischen Entwicklungen an der Alma mater lipsiensis in dieser Zeit.