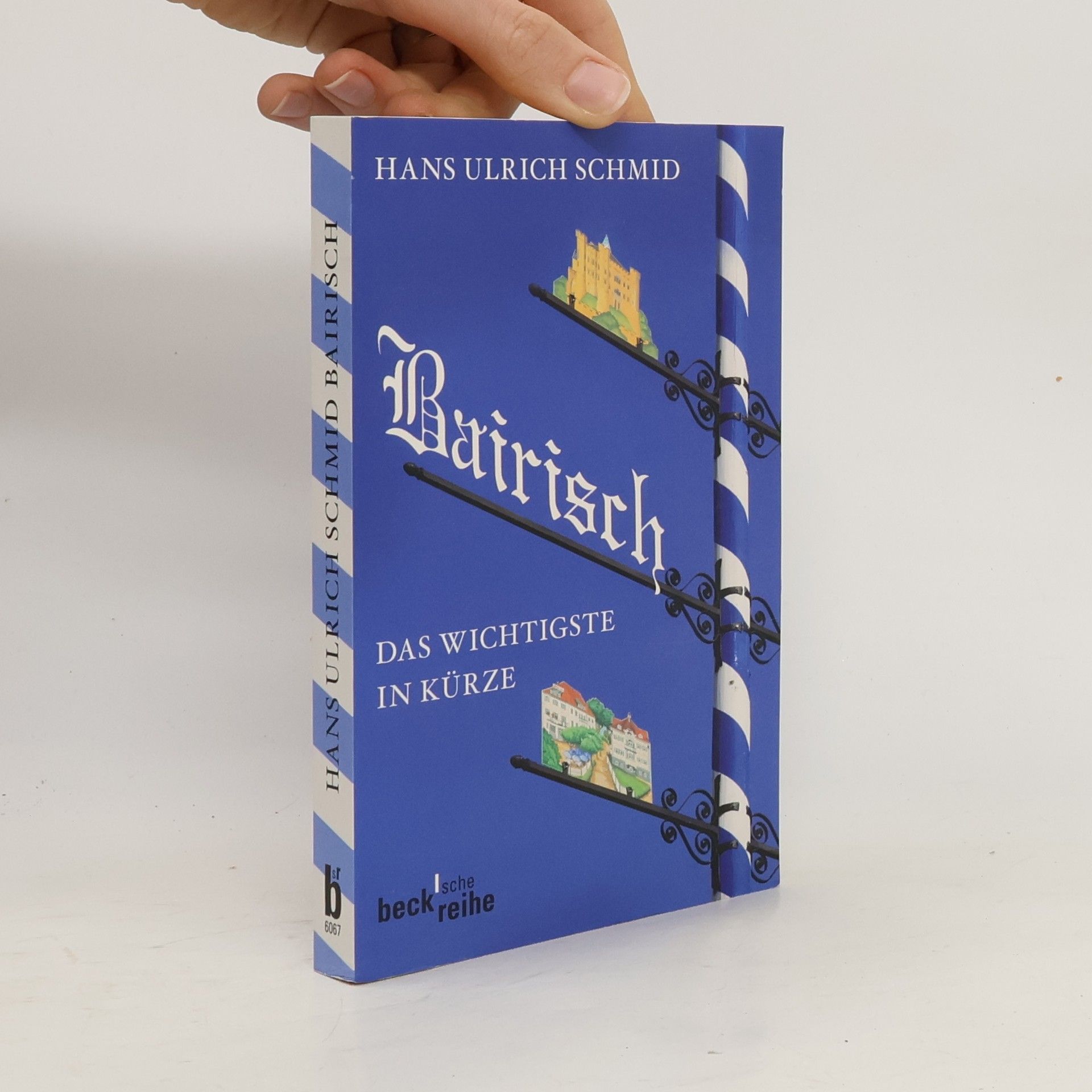Überblick über die Geschichte der deutschen Sprache – vom Althochdeutschen bis zum Frühneuhochdeutschen mit Ausblicken auf die jüngere Sprachgeschichte und die Gegenwartssprache. Der Autor dokumentiert wichtige Sprachstufen anhand zahlreicher Analysebeispiele und stellt die Sprachentwicklung epochenübergreifend auf den verschiedenen Ebenen dar: Laut und Schrift, Wortformen, Satzbau und Wortschatz. Mit kommentierten Textbeispielen, Abbildungen und Tabellen (zu Laut- und Flexionsparadigmen). Optimal für BA-Studiengänge geeignet.
Hans Ulrich Schmid Books



![[Set: Althochdeutsche Grammatik I + II]](https://rezised-images.knhbt.cz/1920x1920/0.jpg)


Die 101 wichtigsten Fragen - deutsche Sprache
- 159 pages
- 6 hours of reading
Seit wann gibt es die deutsche Sprache? Wie viele Wörter hat das Deutsche? Warum hat es so viele Umlaute? Wann gebraucht man Imperfekt und wann Perfekt? Was ist Jiddisch? Und was ist mit dem Friesischen? Wie wird das Deutsche in hundert Jahren aussehen? Hans Ulrich Schmid, Professor für historische deutsche Sprachwissenschaft, wirft einen angenehm unangestrengten Blick auf unsere doch recht komplizierte Sprache mit ihrer langen Entwicklungs- und Vorgeschichte. Das Deutsche, könnte das Fazit lauten, hat sich zwar von jeher weiterentwickelt, aber vieles, was dem heutigen Sprecher unlogisch erscheint, findet eine überraschend plausible Erklärung in der Sprachgeschichte.
[Set: Althochdeutsche Grammatik I + II]
- 982 pages
- 35 hours of reading
Die beiden Bände der Althochdeutschen Grammatik bieten eine umfassende Analyse der Sprache, wobei Band I sich auf Phonologie und Morphologie konzentriert und Band II die Syntax behandelt. Sie sind in enger Abstimmung entstanden und dienen als unverzichtbares Referenzwerk für Forschung und Lehre im Bereich des Althochdeutschen.
Band VIII,1: S-Sn. 10. Lieferung: satulgiziugi bis sisuua
- 40 pages
- 2 hours of reading
Das in zehn Bänden geplante Althochdeutsche Wörterbuch erscheint seit 1952 in Lieferungen bei der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig und wird seit der Lieferung V/15 von Hans Ulrich Schmid herausgegeben. Band VIII (mit s- anlautende Stichwörter) enthält die materialreichste Wortstrecke und wird deshalb in zwei Teilen erscheinen.
Hand und Hals in mittelalterlichen Rechtssprachen der Germania
- 24 pages
- 1 hour of reading
Im (frühen) Mittelalter wurden in Germania Rechtstexte verfasst, die auf älteren mündlichen Traditionen basierten. Diese Aufzeichnungen existieren in lokalen, regionalen und überregionalen Varianten in verschiedenen Landessprachen. Ein herausragendes Beispiel ist der Sachsenspiegel des Eike von Repgow aus dem 13. Jahrhundert, während vergleichbare, teils ältere Texte aus England stammen. Auch das Mittelniederländische und skandinavische Länder liefern reichlich Material. In diesen Texten finden sich ähnliche Wortfügungen. Für die Analyse wurden übereinstimmende feste Verbindungen ("Rechtsphraseologismen") mit den Körperteilbezeichnungen 'Hand' und 'Hals' ausgewählt, wie etwa mittelhochdeutsch mit gemeiner hant oder altenglisch gemæne handum. Die romantische Sprach- und Rechtsgeschichte, personifiziert in Figuren wie Jacob Grimm, interpretiert solche Übereinstimmungen als Belege einer gemeinsamen germanischen Rechtssprache. Während solche Erklärungen nicht vollständig ausgeschlossen werden können, ist es wahrscheinlicher, dass konvergente Entwicklungen oder gegenseitige Beeinflussungen über Sprachgrenzen hinweg eine Rolle spielten. Diese Themen bieten spannende Ansätze für weitere interdisziplinäre Forschungen an der Schnittstelle von Sprach- und Literaturwissenschaft sowie Rechtsgeschichte.
BESCHEIDEN(HEIT)
Metamorphosen eines Wortes
Unser Adjektiv bescheiden und das abgeleitete Substantiv Bescheidenheit haben eine wechselvolle Geschichte. Zugrunde liegt ein mittelhochdeutsches Verbum bescheiden, das "trennen, auseinanderhalten, differenzieren" bedeutete. Wer uber die Fahigkeit dazu verfugte, war bescheiden. Fur dieses Adjektiv (ursprunglich Partizip vom Verb) entwickelte sich die Bedeutung "klug, vernunftig". Und wer uber diese Eigenschaften verfugt, ist "bescheiden" im heutigen Wortsinn. Neuerdings entstand auch eine pejorative Verwendungsweise. In einem zweiten Teil der Darstellung wird der Frage nachgegangen, wie das Wort bescheiden in Worterbuchern des Deutschen (Grimm, Duden, Digitales Worterbuch der Deutschen Sprache = DWDS) behandelt wird. Daran schliessen sich Beobachtungen und Bewertungen der aktuellen Worterbuchsituation, die fur das letztgenannte Werk eher bescheiden (in der jungsten Wortbedeutung) ausfallen.
Während die Mhd. Grammatik von Hermann Paul seit der 20. Auflage (1969) und die Frühneuhochdeutsche Grammatik (1993) - beide in der Reihe "Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte" publiziert - einen Syntaxteil enthalten, erschien in Ergänzung zur "Althochdeutschen Grammatik I" erstmals 2004 ein Teil II "Syntax" von Richard Schrodt, der stark theoretisch geprägt und weniger an einer strukturierten Dokumentation des Materials interessiert war. Die nun vorliegende Neufassung ist im Einklang mit der Zielrichtung der Reihe dagegen stärker materialbezogen. Die Grundstrukturen des Althochdeutschen werden materialbasiert dargestellt. - Die Darstellung beginnt bei den Kasusfunktionen, dokumentiert die elementaren Satzbaupläne auf der Grundlage der Valenzgrammatik. Es folgt eine strukturierte Darstellung des Aufbaus der Nominal- und Verbalphrase, der Satzarten, der Satzfelder (Satzklammer), der Para- und Hypotaxe, der verschiedenen Nebensatzarten und der Negation. Die syntaktischen Strukturen werden, soweit möglich, aus allen Quellengattungen des gesamten althochdeutschen Zeitraums (8. bis 11. Jahrhundert) unter Einschluss des Glossenmaterials belegt.
Wann schreibt man bayrisch mit y und bairisch mit i? Ist Bairisch ein Dialekt oder eine Sprache? Hat das Bairische eine eigene Grammatik? Was sind typisch bairische Wortbildungen, Ortsnamen, Familiennamen? Hat Bairisch eine Zukunft? Der bairische Dialekt, der in großen Teilen Bayerns, Österreichs und in Südtirol gesprochen wird, hat eine über 1000-jährige Geschichte. Das Buch gibt kurzweilig und unterhaltsam einen Überblick über wichtige Stationen der Literatur- und Sprachgeschichte, grammatische und lexikalische Besonderheiten sowie die Rolle des Dialekts in der heutigen Öffentlichkeit.