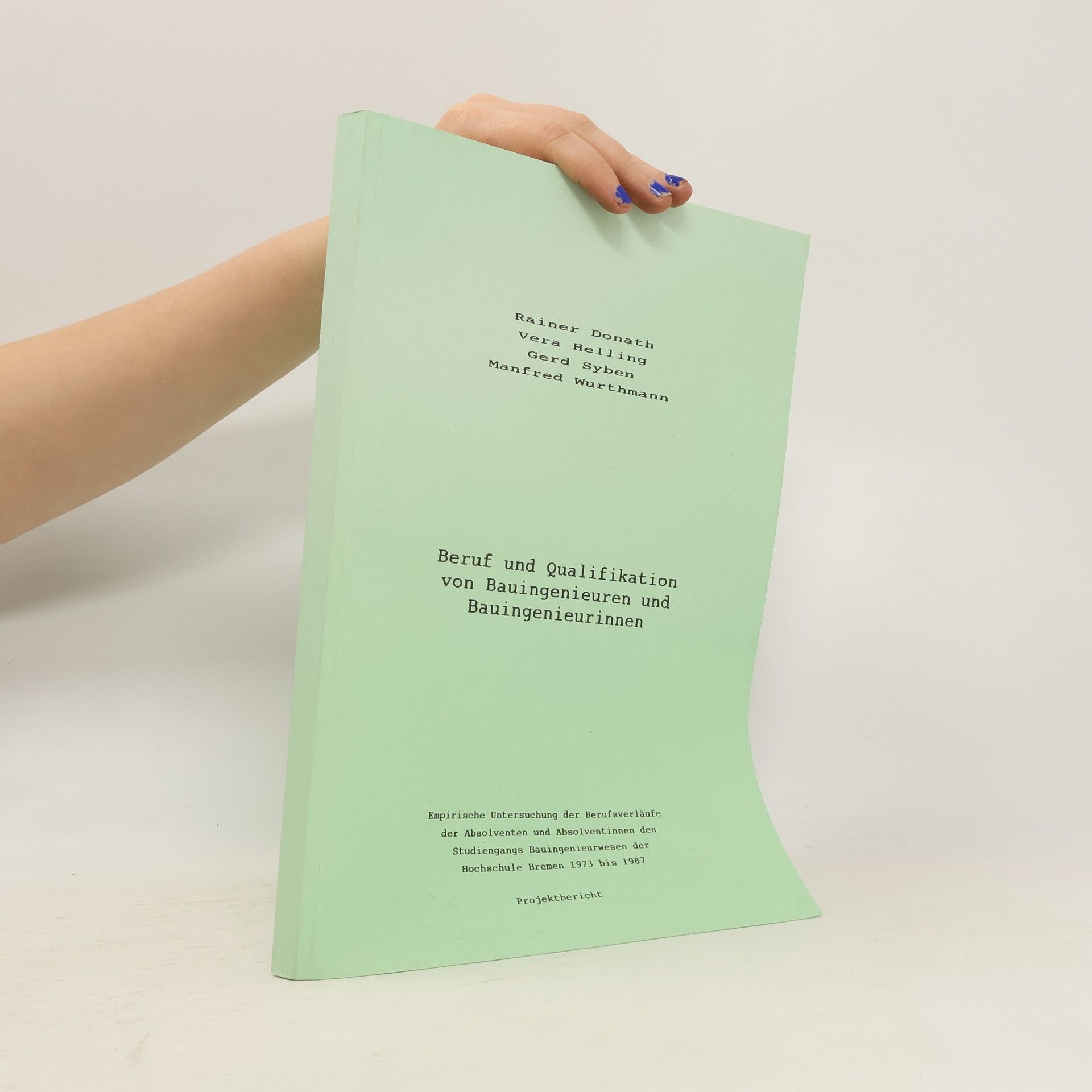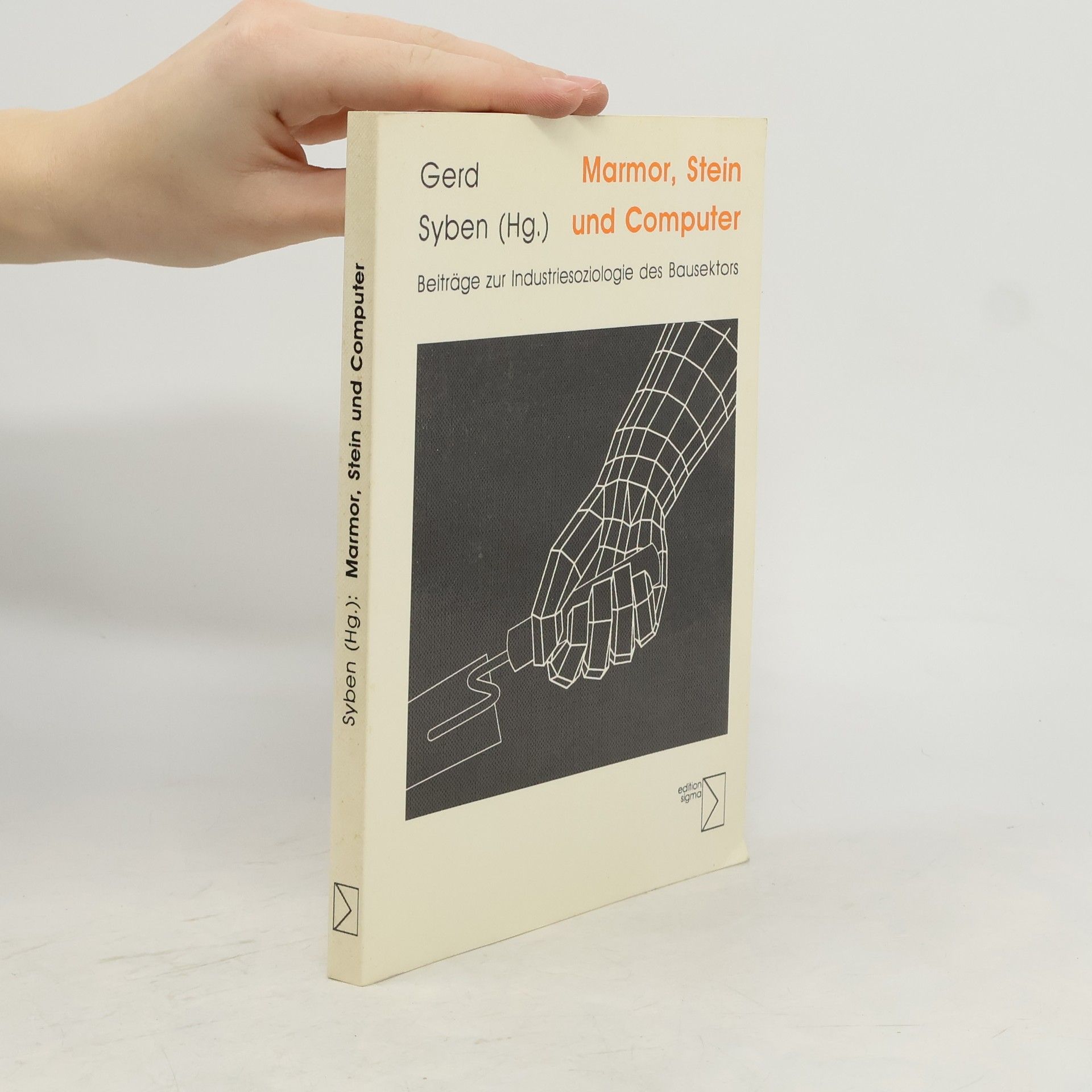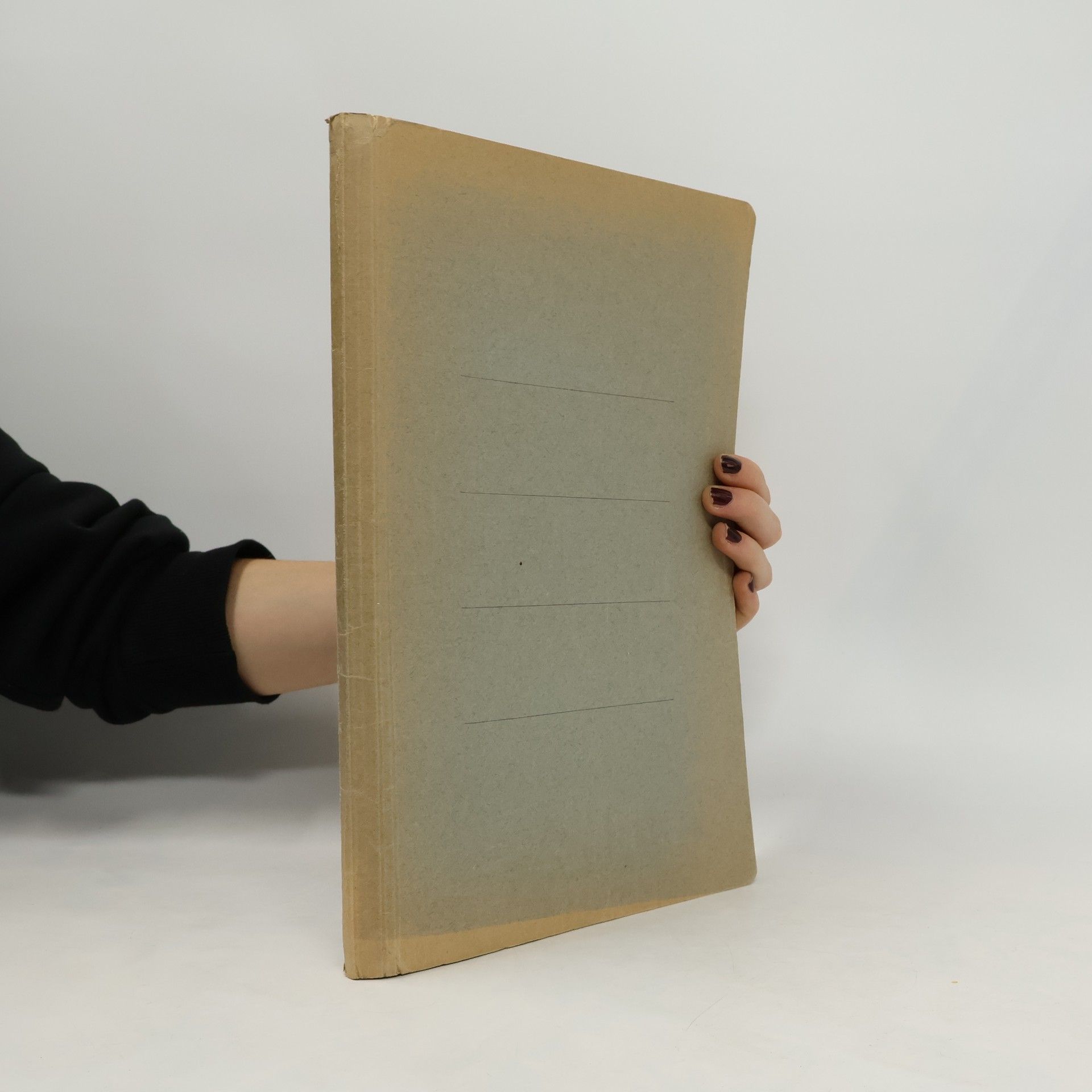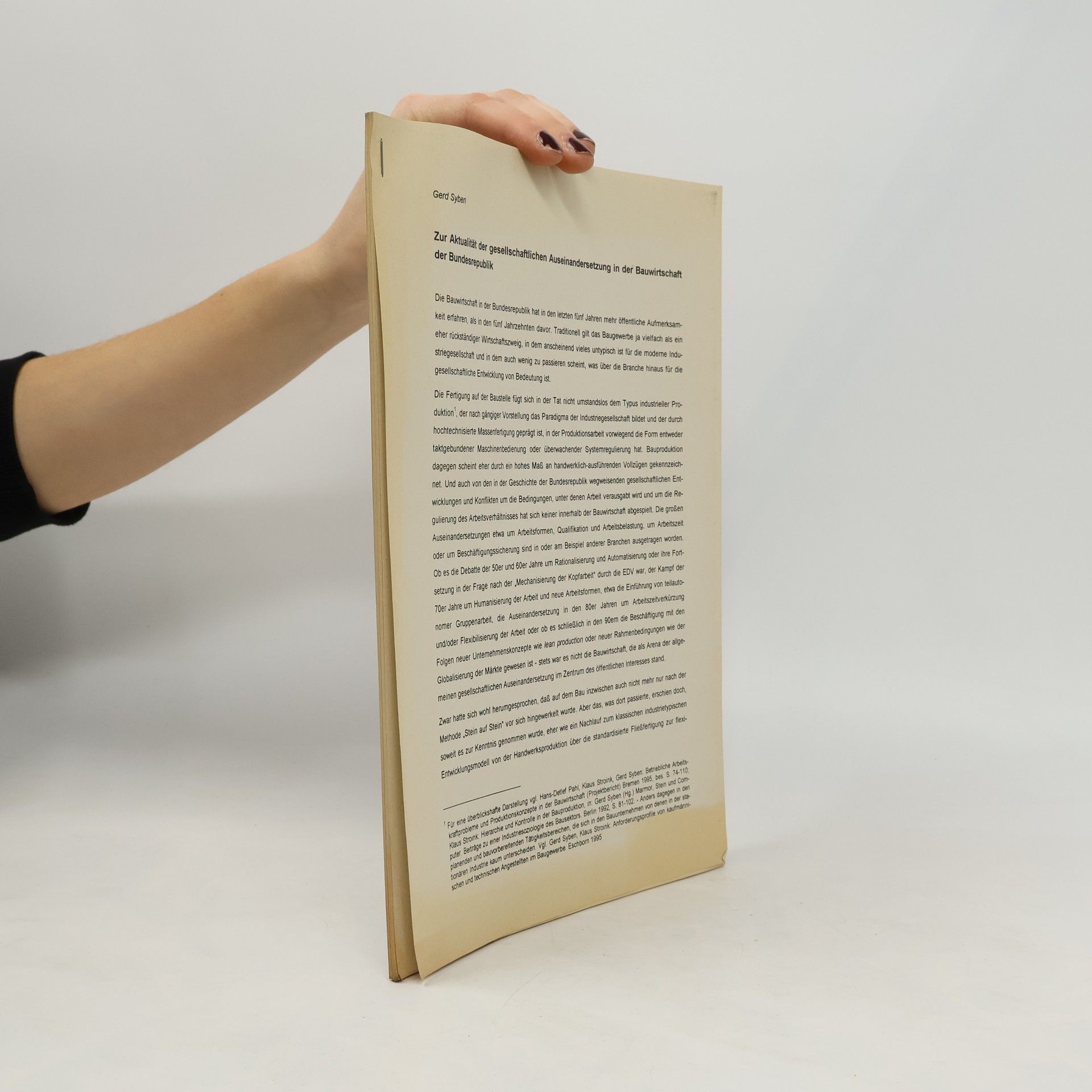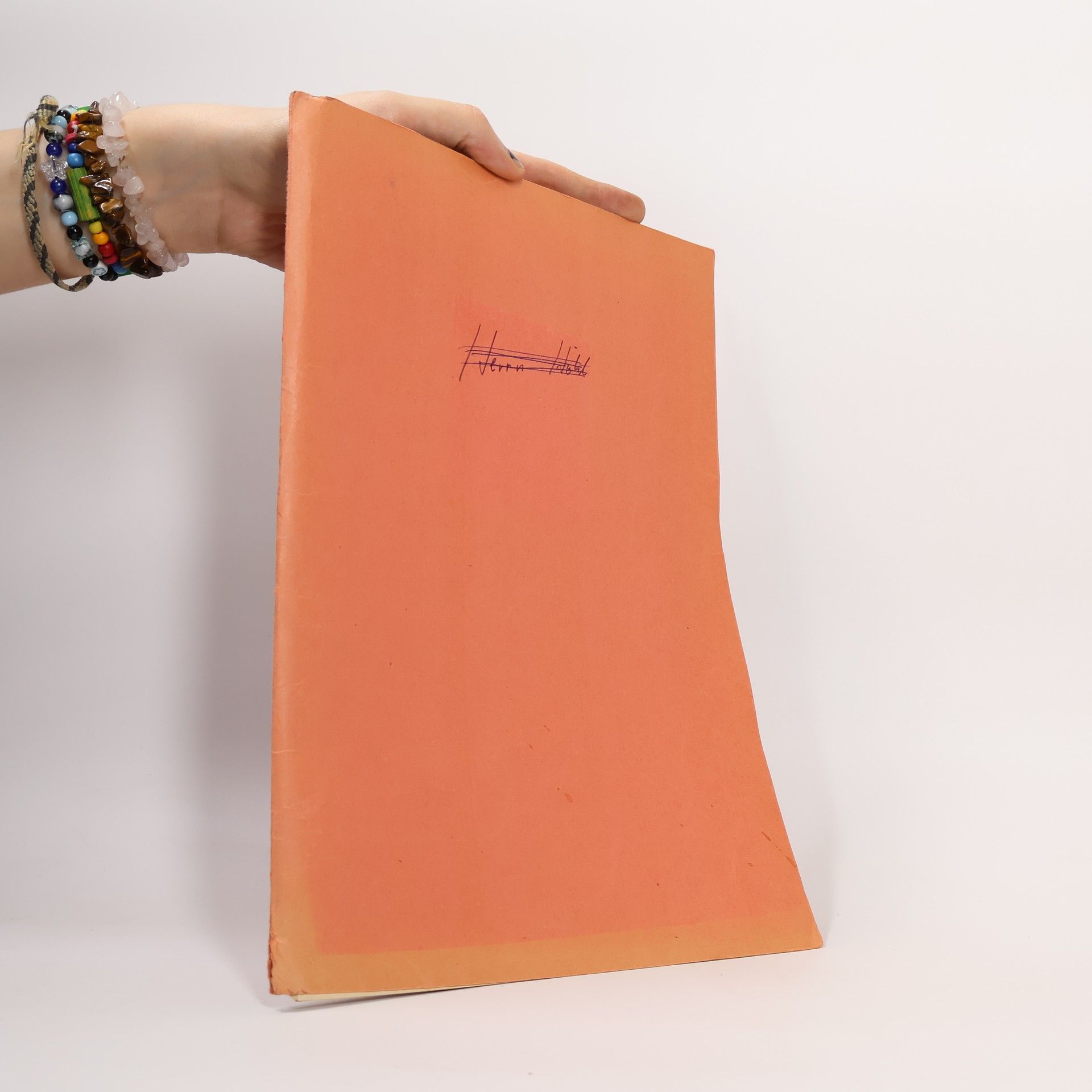Die Baustelle der Bauwirtschaft
- 272 pages
- 10 hours of reading
Syben legt hier - bisher einmalig in der deutschen sozialwissenschaftlichen Literatur - eine umfassende industriesoziologische Bestandsaufnahme der Unternehmensentwicklung und Arbeitskräftepolitik der Bauwirtschaft in der Bundesrepublik vor. Systematisch gegliedert befaßt er sich mit der Branchenstruktur, ihrer Umwälzung unter dem Druck neuer Marktverhältnisse und Wettbewerbsbedingungen und mit den strategischen Optionen der Unternehmen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Der Autor analysiert den Prozeß des Bauens von der Entscheidung des Bauherrn bis zum Betrieb des fertigen Gebäudes, die Umwälzung der Rollen und Machtverhältnisse der Akteure, die Entwicklung der Unternehmen zwischen Global Players, Subunternehmerketten und neuen Tagelöhnern, die betrieblichen Rationalisierungsstrategien und die neuen Anforderungen an die Qualifikation der Beschäftigten, wobei er den Verwerfungen am Arbeitsmarkt und den Gefahren für die Berufsbildung und das System der branchenspezifischen Regulierung besondere Beachtung schenkt. Zugleich entfaltet Syben aus seiner Analyse der stofflichen und gesellschaftlichen Besonderheiten des Absatzes und der Produktion von Bauwerken ein begriffliches Gerüst zur Interpretation der Entwicklung und der Perspektive dieser Branche.