In der Familiengeschichte der Gurlitts erzählt sich das Bürgertum des 19. und 20. Jahrhunderts von seinem Glück und Unglück. Die Pole sind gespannt zwischen Kaufmannschaft und Künstlertum, Freiheit und Beamtendasein, Deutschland, Österreich-Ungarn, Japan. 14 Fallstudien entfalten das Netzwerk einer Familie und damit die Innenseite unser Geschichte. Um den Maler Louis Gurlitt, der die Schwester der deutsch-jüdischen Schriftstellerin Fanny Lewald heiratete, ranken sich Geschichten. Viele davon berichtet sein Sohn in der Biographie, die er 1912 veröffentlichte, als das deutsche Bildungsbürgertum zu zerfallen begann. Andere finden sich in Archiven, Nachrufen, Briefen, im Familienaustausch über private, politische oder zu verschweigende Ereignisse.14 Autor:innen haben diese Lebens- und Karriereschicksale untersucht, sie berichten von Künstlertum, Kaufmannschaft oder beidem zugleich, von Schulen und Universitäten, vom Krieg, von der Sichtbarkeit oder Unsichtbarkeit der Frauen... Die Beiträge orientieren sich an Schwerpunkten, zeigen das 'Andere' der Zeitungsmeldungen um Raubkunst und Opportunismus und machen sich auf den Weg, eine Familie in ihren Verflechtungen und ihrem Selbstverständnis zu begreifen. Sie verdichten unser kulturelles Gedächtnis und damit die "Wissenschaft von den geselligen Lebensverhältnissen" (Karl August van Ense).
Rainer Bayreuther Books

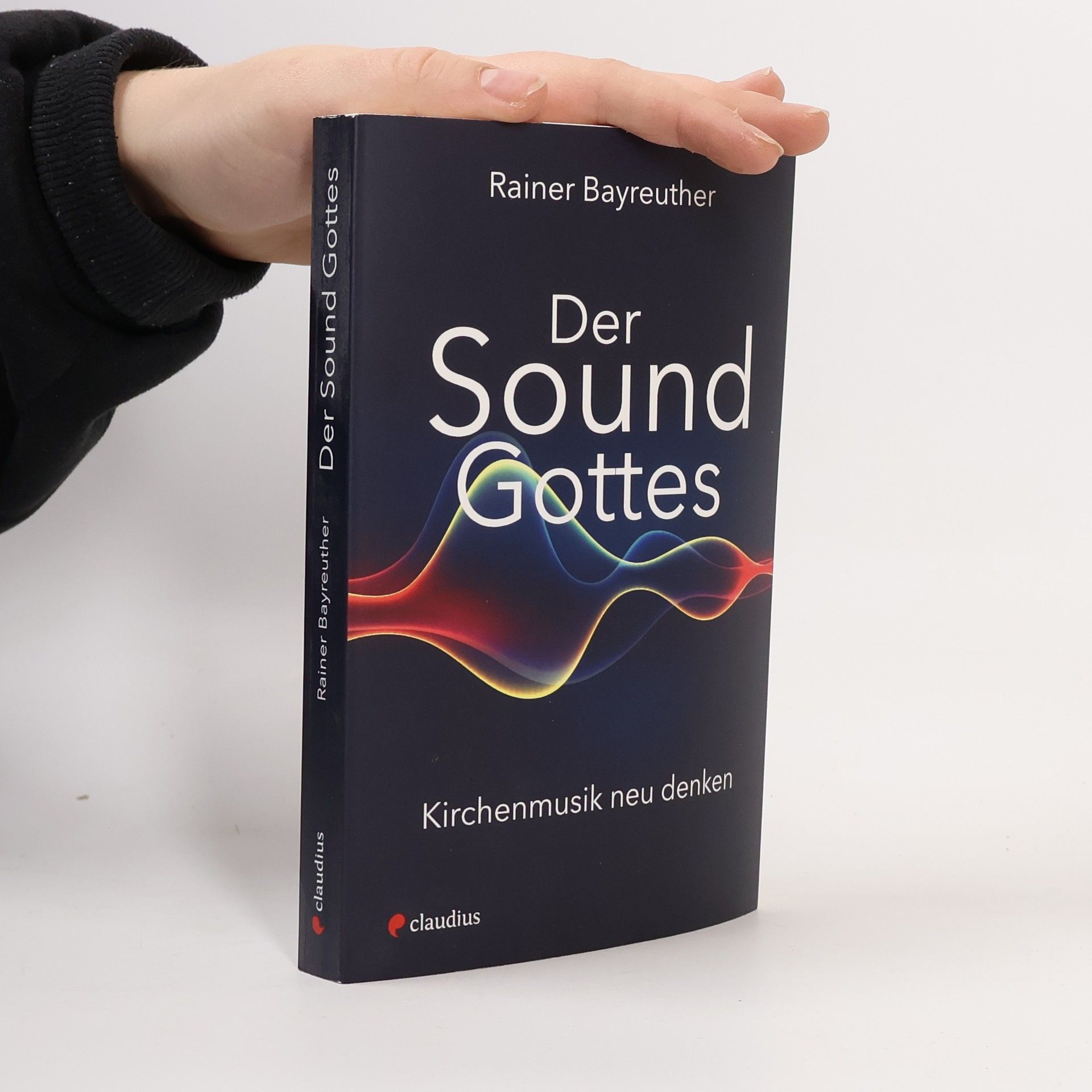

Der Sound Gottes
Kirchenmusik neu denken
Es ist die falsche Frage, ob wir bei der Suche nach dem Sound Gottes noch Gesangbuchlieder oder Bachkantaten singen oder ob wir es bleiben lassen sollen. Die richtige ist: Wie muss die Performance eines Gesangbuchlieds oder einer Kantate gedacht, komponiert, dekomponiert werden, damit durch sie der Sound Gottes strömt? Rainer Bayreuther spricht sich leidenschaftlich für mehr experimentellen Mut in der Kirchenmusik, für den Einsatz auditiver Medien und die kreative Verknüpfung von digitaler und menschlicher Kommunikation aus. „Ich führe keinen musikalischen Bildersturm im Schilde. Ich gebe schlicht zu bedenken, dass ein göttliches Eingreifen im Klangereignis jenes Klangereignis inkommensurabel verändert.“
Der digitale Gott
Glauben unter technologischen Bedingungen
Waren die Apostel die Vorläufer der heutigen Influencer? Ihre Präsenz konnten sie zwar nicht in sozialen Netzwerken nutzen, aber auch sie übten durch ihre Bekanntheit starken Einfluss aus. Auch zu unseren heutigen Emojis finden sich Vorläufer, so nutzten die frühen Christen den Fisch als Symbol zur Verständigung. Nichts liegt daher näher, als sich mit der Frage zu beschäftigen, wie sich fortschrittliche Technik und Glaube produktiv verbinden lassen. Denn die Digitalisierung wird nach und nach alle Bereiche der christlichen Frömmigkeit erfassen. Dem Glauben an Jesus Christus steht ein tiefgreifender Wandel bevor. Aber nicht der Untergang. Ein leidenschaftliches Plädoyer von Rainer Bayreuther für digitalen Fortschritt in der Kirche.