Der Duisburger Hafen, ursprünglich 1716 in Ruhrort gegründet, entwickelte sich über 300 Jahre zu einer führenden Logistikdrehscheibe in Zentraleuropa. Er verbindet geografische Vorteile mit logistischem Know-how und sichert über 45.000 Arbeitsplätze in der Region, was ihn zu einem wichtigen Projekt des Strukturwandels macht.
Christiane Fritsche Books
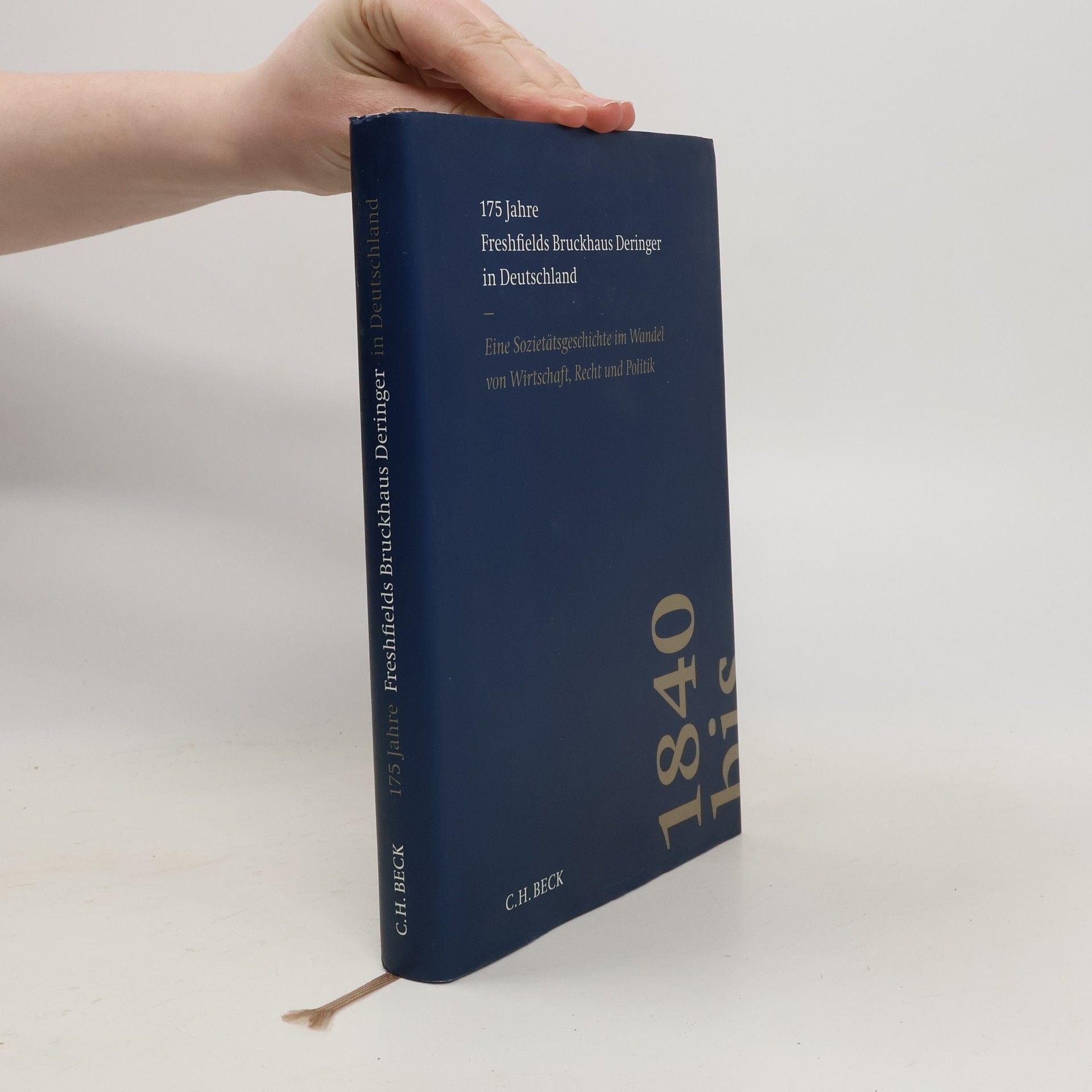
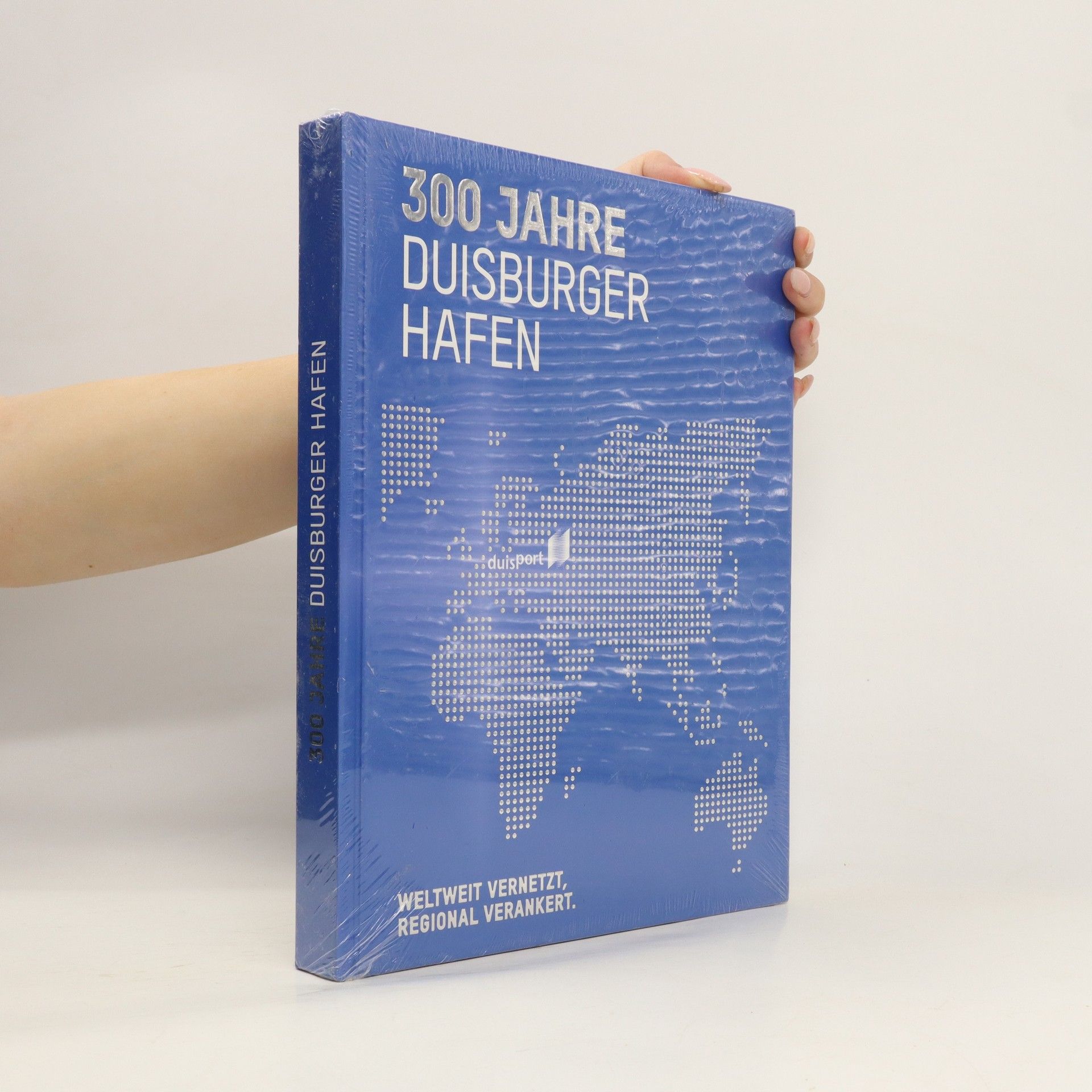
175 Jahre Freshfields Bruckhaus Deringer in Deutschland
Eine Sozietätsgeschichte im Wandel von Wirtschaft, Recht und Politik