Friedhelm Decher Books

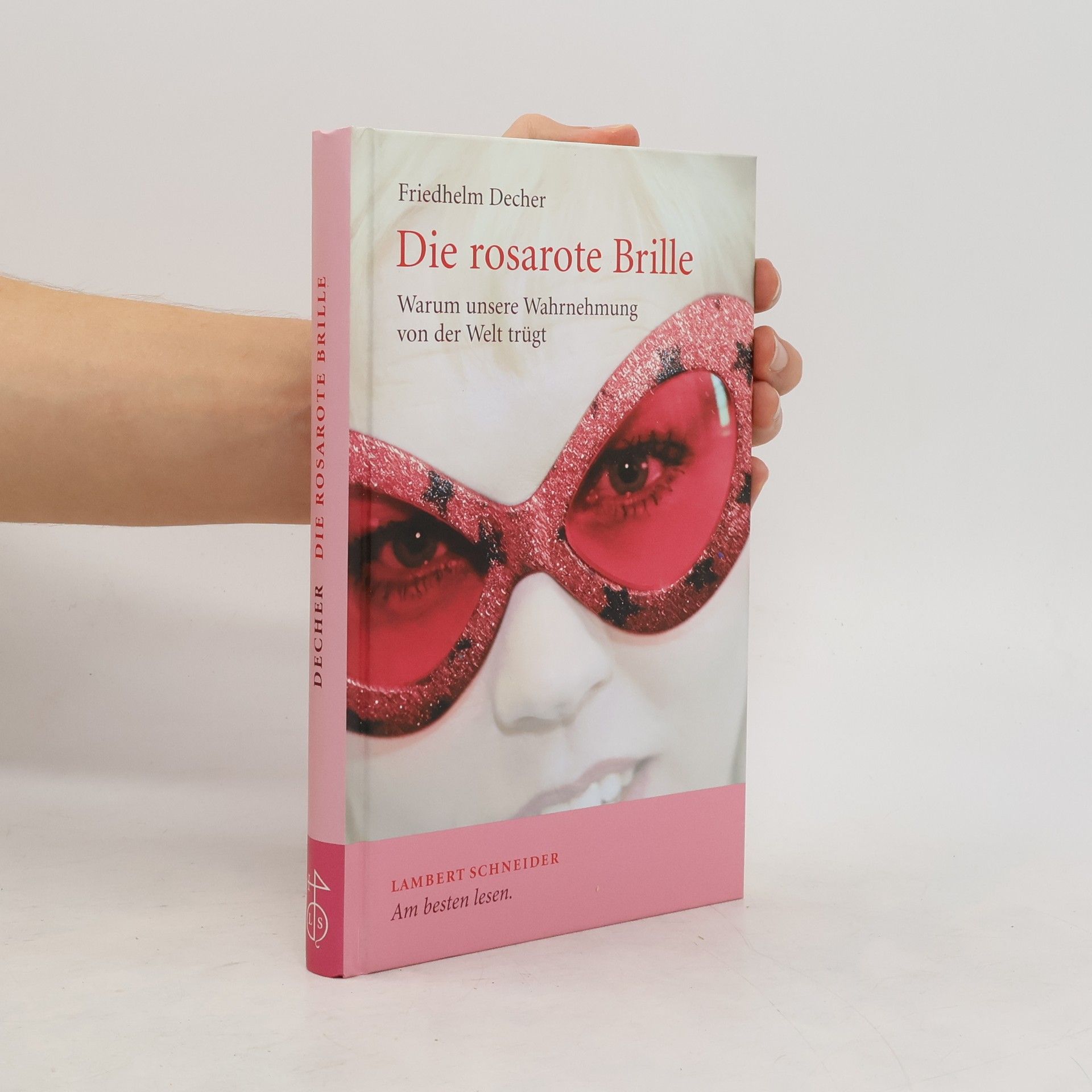
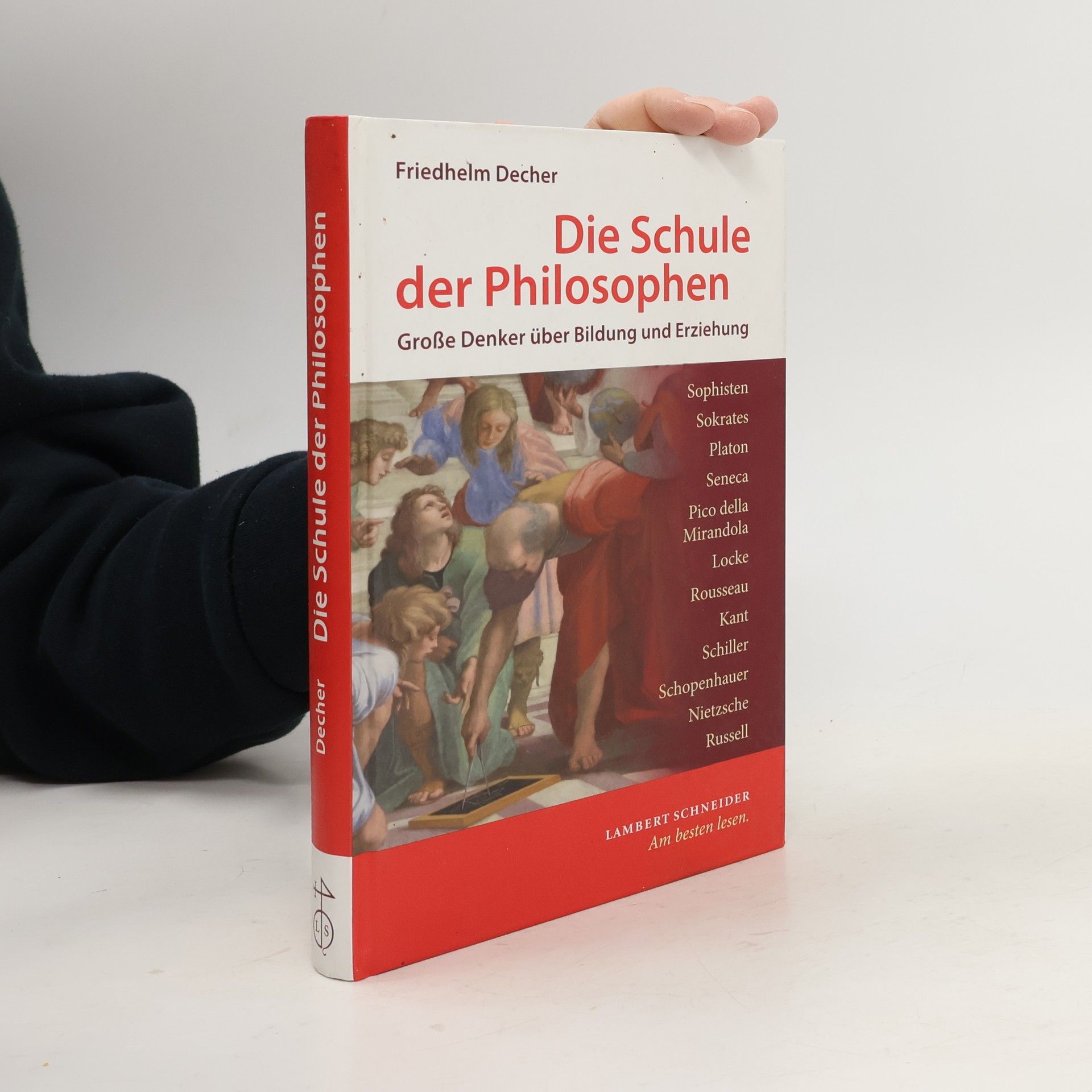


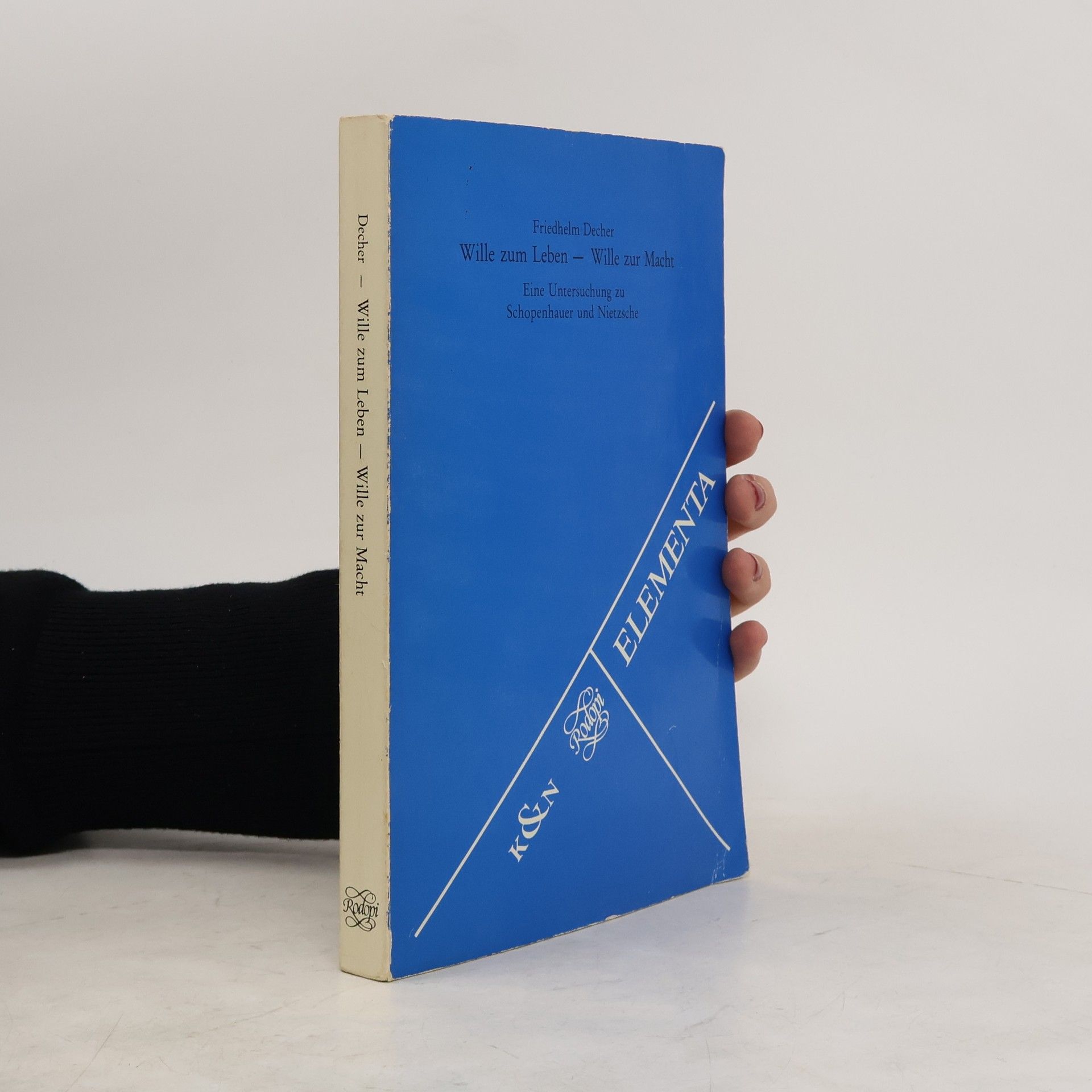
Ist es den Menschen erlaubt, sich selbst zu töten oder müssen sie, trotz aller Widrigkeiten, auf ihrem Platz im Leben ausharren? Friedhelm Decher weist nach, daß sich zwei Argumentationsstränge für und wider die Erlaubtheit der Selbsttötung durch die ganze Philosophiegeschichte ziehen. 1. Der Mensch hat sein Leben einer anderen Instanz als sich selbst zu verdanken, etwa einer göttlichen. Was er nicht selbst geschaffen hat, darf er aber nicht einfach zerstören. Ergo ist Selbstmord moralisch verboten. 2. Der Mensch hat einen freien Willen, durch den er nur im Verhältnis zu anderen Personen moralisch gebunden ist, im Verhältnis zu sich selbst aber nicht. Ergo ist Selbstmord erlaubt. Trotz ihres unüberbrückbaren Gegensatzes aber gehen beide Argumentationsstränge von einer gemeinsamen Annahme aus: daß Selbstmord die Signatur der Freiheit des Menschen ist. Friedhelm Decher legt die erste große und gut lesbare Abhandlung über die Haltung der Philosophen zum Selbstmordproblem vor. „Wer mehr oder weniger trockene Phliosophiegeschichte erwartet hatte, wird überrascht sein: von Anfang an geht es um eine Auseinandersetzung, die auch heute noch nicht beendet ist, und das so geweckte Interesse spürt nun aufmerksam den unterschiedlichen Standpunkten durch die Jahrhunderte nach.“ www, philosophie-online. de
Handbuch der Philosophie des Geistes
- 302 pages
- 11 hours of reading
Friedhelm Decher bietet in diesem Überblickswerk eine einzigartige problemgeschichtliche Darstellung der Philosophie des Geistes. Er stellt eine Auswahl der wichtigsten philosophischen Theorien und Standpunkte zum Geist in der abendländischen Geistesgeschichte vor, die von der Antike bis heute reicht. Von Homer bis Platon und von Descartes bis Searle werden Positionen, Ansätze und Vorstellungen von Geist, Seele und Bewusstsein beschrieben, die charakteristisch für die philosophische Diskussion waren und diese zum Teil bis in die Gegenwart prägen. Sein ebenso spannendes wie verständliches Panorama reicht bis hin zu aktuellen Debatten um den Geist und seine Funktionsweise im Spannungsfeld von Philosophie und den Neurowissenschaften. So gelingt es Decher, entscheidende Facetten dieses philosophischen Kernthemas herauszustellen.
Die Frage nach Bildung und Erziehung ist aktueller denn je. Dabei haben die philosophischen Konzepte von Bildung, Erziehung und Aufklärung die abendländische Kultur und Geistesgeschichte maßgeblich geprägt. Von Beginn an wird unsere Kultur von Fragen bestimmt, die im Kern philosophisch sind: Wie kann die eigene Existenz gelingen, und was ist das Ziel derselben? Wie unabhängig kann der Mensch sein, und wie wird er gleichsam zu einem sozialen und politischen Wesen? Ist Bildung Selbstzweck oder nur Mittel zur Erreichung eines übergeordneten Ziels? Welche ›höheren‹ Werte (neben bloßen Fertigkeiten und Kenntnissen) soll Bildung vermitteln? Welchen Stellenwert hat dabei die ästhetische Erziehung des Menschen? In dem vorliegenden Band stellt Friedhelm Decher sachkundig und allgemein verständlich die Bildungstheorien zwölf wichtiger Denker unserer abendländischen Kultur dar und zeigt wie nachhaltig die philosophischen Konzepte die abendländische Kultur und Geistesgeschichte geprägt haben.
Sind wir Menschen wirklich so autonom, wie wir für gewöhnlich glauben? Oder sind wir nicht vielmehr durch Manipulationen unterschiedlichster Art getäuschte Wesen, deren Handlungen oftmals eher irrationalen als rationalen Beweggründen folgen? Friedhelm Decher zeigt in diesem Buch, dass unsere Wahrnehmung von der Welt trügt: Auf dem Weg zur Erkenntnis haben wir eine Vielzahl an Hürden zu überspringen. Auf kurzweilige Art und ohne Fachjargon informiert Decher über das Wesentliche, was in den letzten 50 Jahren über Sinnestäuschungen und Manipulationstechniken herausgefunden wurde. Gleichzeitig ist das Buch eine gut lesbare Einführung in philosophische Konzepte zum Verhältnis von Welt und Erkenntnis.
Ständig versuchen Politiker, ihre Gegner mit dem Vorwurf zu beschädigen, sie wollten 'Neidkampagnen' entfesseln oder 'Sozialneid' schüren. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht von 'Neidpopulismus' oder gar von einer 'Neidgesellschaft' die Rede ist. Nun ist Neid kein neues Thema. Die dämonische Natur dieses Affekts hat die gesamte Geistesgeschichte beschäftigt. Wie kann sich Neid so tief in die menschliche Seele eingraben? Warum beschädigt er so nachhaltig das Zusammenleben der Menschen? Friedhelm Decher arbeitet in seinen philosophischen Erkundungen zunächst das Verhältnis zu verwandten Affektlagen wie Rivalität, Schadenfreude, Eifersucht oder Mißgunst heraus. Dabei tritt die Triebfeder des Neids hervor: das Sich-Vergleichen mit anderen. Aber der Autor begnügt sich nicht mit der bloßen Diagnose, er stellt auch die möglichen Umgangsweisen mit diesem Affekt vor.