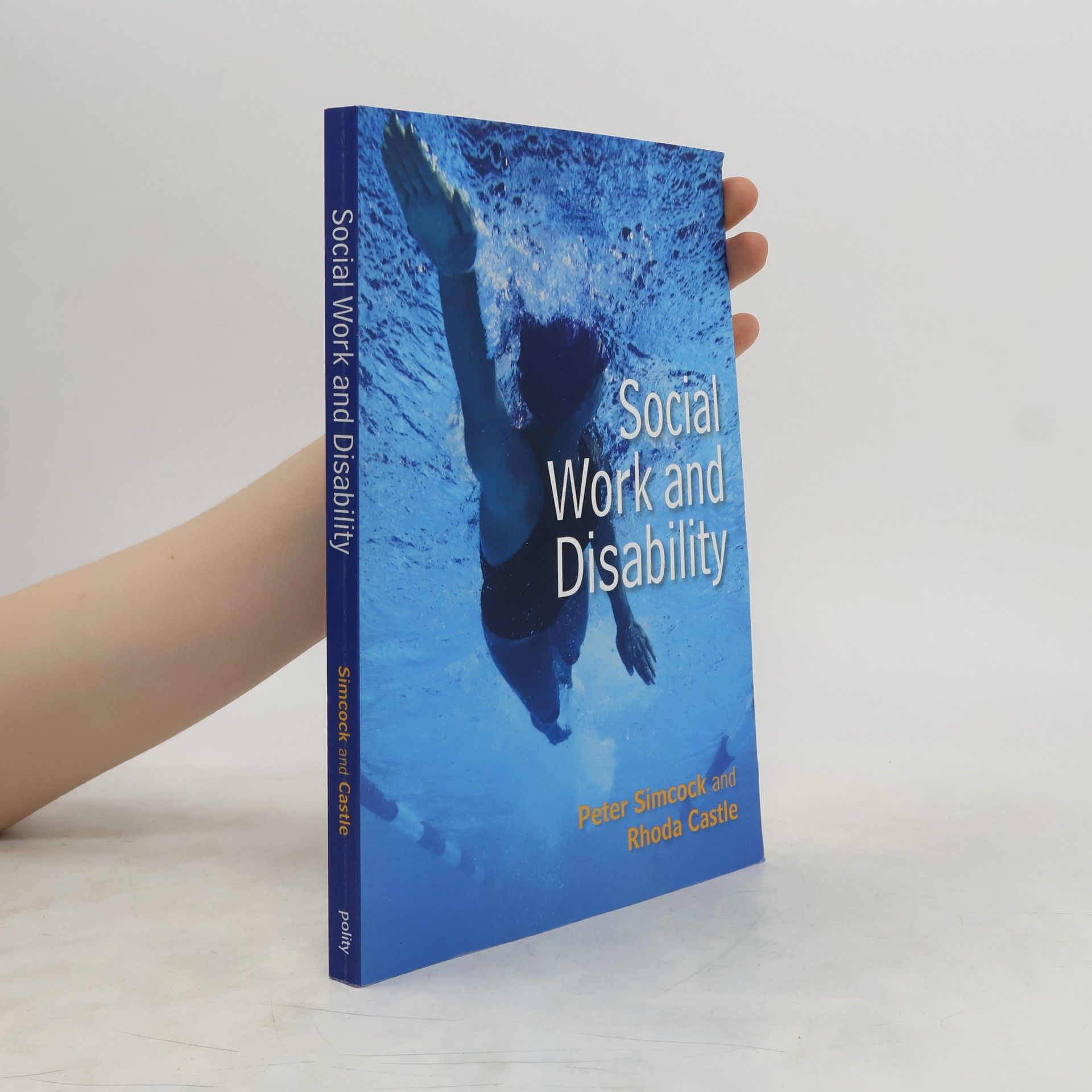Social Work and Disability
- 272 pages
- 10 hours of reading
Social Work and Disability offers a contemporary and critical exploration of social work practice with people with physical and sensory impairments, an area that has previously been marginalized within both practice and academic literature.