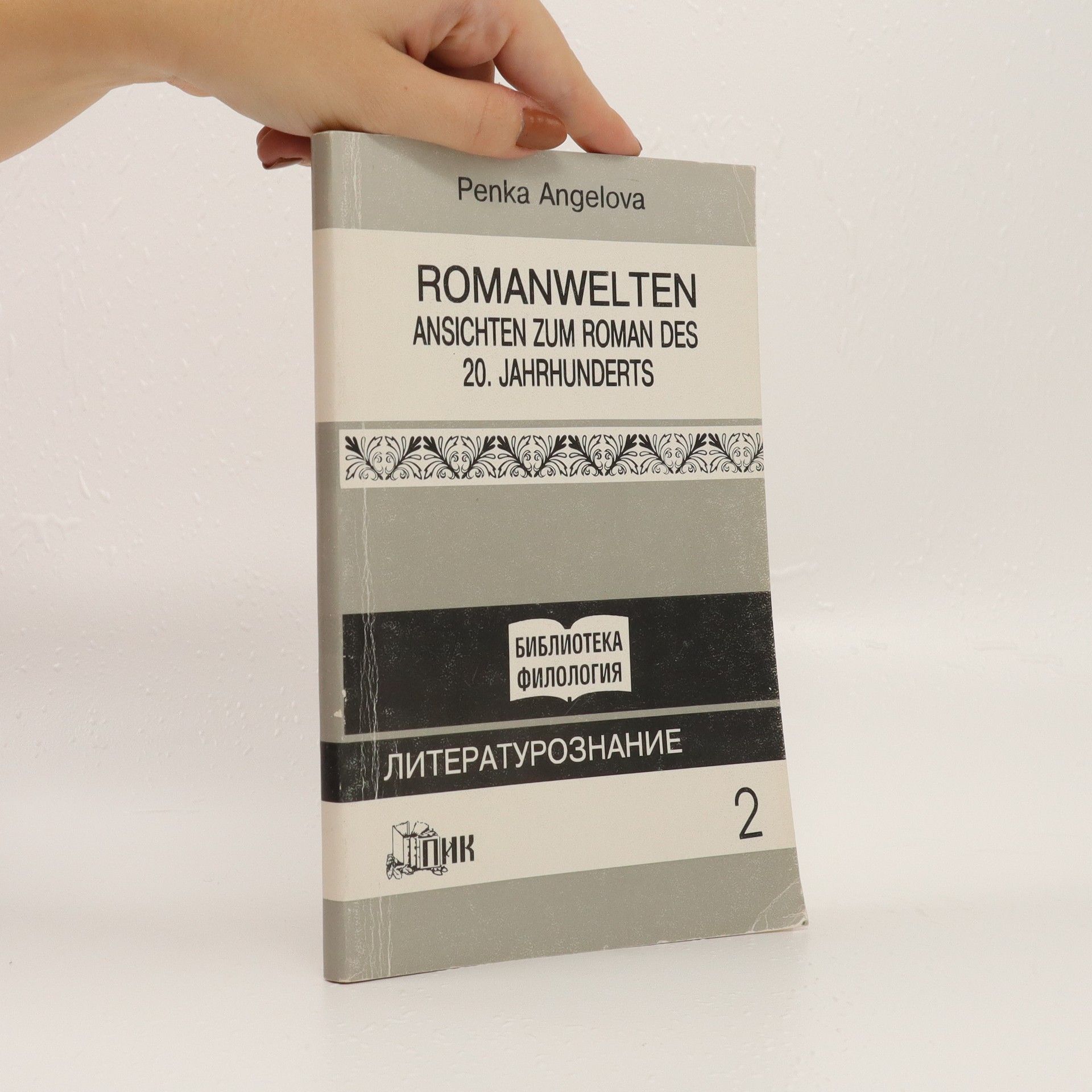Elias Canetti: Masse, Macht, Politik
- 222 pages
- 8 hours of reading
„Me und Macht“, Elias Canettis zentrales, 1960 erstmals veröffentlichtes Werk, ist aktueller denn Vieles, was das derzeitige politische Geschehen prägt, scheint darin vorweggenommen. Und auch Canettis Methodik bietet uns nach wie vor spannende mit klaren Begrifflichkeiten zu Phänomenen wie Me, Macht, Politik oder Medien, mit mutigen Annäherungen an Konzepte von Erinnerung und Erkenntnis, oder mit noch heute visionär anmutenden, die gängigen Grenzen der Disziplinen weit hinter sich lenden theoretischen Denkansätzen.Durch seine Biografie wurde Canetti zunächst gezwungenermaßen, dann durch bewusste Entscheidung zum „europäischen Bürger par excellence“. In Ruse (Rustschuk) im heutigen Bulgarien geboren, verbrachte er viele Jahre in seiner „zweiten Heimat“ Wien; er lebte in Deutschland, England und am Ende in der Schweiz. In diesem Band werden zentrale Texte des Nobelpreisträgers Canetti einer Relektüre unterzogen, ihre Aktualität und Verbreitung von internationalen Expertinnen und Experten überprüft. Verschiedene Rezeptionsansätze gehen zudem auf Canettis Interkulturalität und seine Vision eines Zusammenlebens jenseits nationaler Zugehörigkeiten ein, nicht zuletzt im Hinblick auf Migrationsbewegungen und „Fluchtmen“ der letzten Jahre.